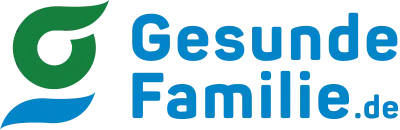Alt, aber gefährlich? Persistente Schadstoffe in langlebigem Spielzeug
Alte Spielsachen wecken Erinnerungen und schonen Umwelt sowie Geldbeutel. Doch diese langlebigen Lieblingsstücke aus vergangenen Jahrzehnten können versteckte Schadstoffe bergen, die früher erlaubt waren und heute als gesundheitsschädlich gelten. Warum ausgerechnet Vintage-Spielzeug ein Risiko für Kinder darstellen kann und worauf Eltern bei Second-Hand-Spielzeug achten sollten, erklärt dieser Artikel.
 Nostalgisch, aber potenziell giftig: In alten Spielzeugen können auch nach Jahrzehnten noch gefährliche Chemikalien stecken.
Nostalgisch, aber potenziell giftig: In alten Spielzeugen können auch nach Jahrzehnten noch gefährliche Chemikalien stecken.
Warum altes Spielzeug Schadstoffe enthalten kann
Älteres Spielzeug stammt oft aus Zeiten mit weniger strengen Vorschriften. In den 1970er, 80er oder 90er Jahren waren gesundheitsschädliche Chemikalien in Kinderprodukten teilweise gang und gäbe. Hersteller setzten Weichmacher, Schwermetalle oder Flammschutzmittel großzügig ein, weil es erlaubt war und man die Risiken noch nicht kannte. Phthalate etwa – eine Gruppe von Weichmachern – durften in der EU bis Mitte der 2000er-Jahre in Spielzeug verwendet werden. Diese Stoffe machten Plastik biegsam und weich, waren aber kaum reguliert. Auch kurzkettige Chlorparaffine (bestimmte Flammschutzmittel) oder giftige Farbpigmente gehörten früher zum „Rezept“ mancher Spielsachen. Erst spätere Gesetze wie die EU-Spielzeugsicherheitsrichtlinie zogen Grenzwerte ein, doch sie galten nur für neues Spielzeug – alte Spielwaren fielen durchs Raster.
Hinzu kommt, dass viele dieser Chemikalien persistent sind – sie bauen sich nicht von selbst ab. In robusten Materialien wie Plastik, Gummi oder Lack überdauern sie Jahrzehnte. Ein alter Gummiball oder eine Puppe von vor 30 Jahren kann heute noch nahezu die gleiche Chemikalien-Ladung in sich tragen wie am ersten Tag. Studien bestätigen das: In einer schwedischen Untersuchung fanden Forscher bei 84 % der gebrauchten Spielzeuge bedenkliche Chemikalien, darunter massenhaft Phthalat-Weichmacher und Chlorparaffin-Flammschutzmittel. Zum Vergleich: Bei neueren Spielsachen lagen „nur“ rund 30 % über den aktuellen Grenzwerten – ältere Produkte waren also deutlich stärker belastet.
Gefährliche Altlasten: Phthalate, Schwermetalle & Co.
Welche Schadstoffe können sich nun konkret in altem Spielzeug verbergen, und warum sind sie problematisch?
-
Phthalate (Weichmacher): Sie stecken vor allem in weichem PVC-Plastik – zum Beispiel in alten Puppen, Gummienten, aufblasbaren Bällen oder biegsamen Vinylfiguren. Phthalate sind nicht fest an den Kunststoff gebunden und können mit der Zeit herauslösen. Sie wirken hormonell auf den Körper: Einige Phthalate stören das Hormonsystem, beeinflussen die Entwicklung der Geschlechtsorgane und können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Studien bringen sie auch mit Übergewicht und Diabetes in Verbindung. In einem Test fanden Forscher in alten Plastikbällen extrem hohe Phthalat-Gehalte – teils 40 % des Spielzeug-Gewichts, rund 400-fach über dem heutigen EU-Grenzwert. Diese Weichmacher bleiben so lange im Material, bis es vollständig spröde und brüchig wird – ein Prozess, der sich über Jahrzehnte hinziehen kann.
-
Schwermetalle (z. B. Blei, Cadmium): Früher wurden giftige Metalle häufiger in Farben, Kunststoffen oder Metallspielzeugen eingesetzt. Blei etwa fand sich in mancher Spielzeuglackierung oder in Legierungen kleiner Spielfiguren. Blei ist hochgiftig – es kann bei Kindern die geistige Entwicklung beeinträchtigen und den IQ senken und wirkt zudem fortpflanzungsschädigend. Cadmium, ein weiteres Schwermetall, diente früher als Farbstoff (etwa für leuchtendes Rot oder Gelb in Kunststoffen). Eine britische Studie zeigte, dass bestimmte alte LEGO-Steine aus den 1960er- und 70er-Jahren hohe Cadmiumanteile aufwiesen, weit oberhalb heutiger Grenzwerte. Wenn solche Bausteine abgenutzt sind oder Kinder daran lutschen, können diese Metalle in den Körper gelangen. Schwermetalle reichern sich an und können Organe (Nerven, Nieren, Leber) schädigen.
-
Flammschutzmittel: Seit den 1970ern wurden vielen Kunststoffen Flammschutz-Chemikalien beigemischt, um sie schwer entflammbar zu machen. Dazu zählen bromierte Flammschutzmittel (wie PBDEs, die erst ab den 2000ern schrittweise verboten wurden) und chlorierte Paraffine. Diese Stoffe sind oft persistent (sie werden auch „Ewigkeitschemikalien“ genannt) und können sich in Mensch und Umwelt anreichern. Einige stehen im Verdacht, krebserregend zu sein oder das Erbgut zu schädigen. In der genannten schwedischen Studie wurden kurzkettige Chlorparaffine in vielen älteren Spielsachen entdeckt. Auch alte Schaumstoffe oder Elektronik-Bauteile in Spielzeug könnten bromierte Flammschutzmittel enthalten. Diese Substanzen können über Hautkontakt oder Hausstaub aufgenommen werden und belasten auf lange Sicht den Körper.
Neben diesen Hauptkategorien gibt es weitere Chemikalien: z. B. früher gebräuchliche Lösungsmittel in Klebern oder Farben, die heute reguliert sind, oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in alten Gummiteilen (wie Gummireifen von Spielzeugautos oder schwarzen Plastikgriffen). Viele dieser Altstoffe gelten als giftig für Organe oder sogar als krebserzeugend. Kurz gesagt: Das gemütliche Holzspielzeug von damals ist meist unbedenklich – aber überall dort, wo Plastik, Gummi oder bunte Lacke im Spiel sind, lohnt sich ein genauer Blick auf das Alter und die Zusammensetzung.
Gesundheitsrisiken für Kinder
Die Präsenz solcher Schadstoffe in Spielsachen ist besonders brisant, weil Kinder sehr empfindlich darauf reagieren. Ihr Stoffwechsel und Organismus befinden sich in Entwicklung, und sie nehmen Gifte schneller auf als Erwachsene. Außerdem wandert Spielzeug bei Kleinkindern gerne in den Mund – dadurch können Chemikalien direkt in den Körper gelangen (z. B. Weichmacher, die im Speichel löslich sind, oder bleihaltiger Lack, der abblättert).
Viele der genannten Stoffe entfalten über lange Zeit ihre Wirkung: Hormonell wirksame Weichmacher können zu Entwicklungsstörungen führen, etwa vorzeitige Pubertät oder spätere Fertilitätsprobleme. Blei und gewisse Flammschutzmittel können das Nervensystem schädigen – Konzentrationsschwierigkeiten, geringerer IQ und Verhaltensauffälligkeiten werden damit in Verbindung gebracht. Einige dieser Schadstoffe stehen außerdem im Verdacht, Krebs auszulösen oder genetische Schäden zu verursachen. Die Gefahr ist nicht akut sofort spürbar, sondern schleichend: Es geht um mögliche Langzeitwirkungen, die durch ständige geringe Exposition entstehen. Daher warnen Experten, alte belastete Spielsachen im Alltag von Kindern lieber zu meiden, auch wenn sie äußerlich noch so harmlos wirken.
Woran erkennt man unbedenkliches Spielzeug? – Tipps für Eltern
Trotz all dieser Informationen müssen Eltern nicht jedes alte Spielzeug panisch aussortieren. Worauf sollte man achten, um auf der sicheren Seite zu sein?
-
Alter und Material prüfen: Überlegen Sie, aus welchem Jahr(zehnt) das Spielzeug stammt. Besonders vorsichtig sollte man bei weichem Plastik sein, das vor 2007 hergestellt wurde – hier können verbotene Phthalate enthalten sein. Solche alten Weichplastik-Spielzeuge (Puppen, Gummitiere, Bälle) besser nicht an kleine Kinder weitergeben. Auch bei sehr alten Kunststoff-Bausteinen (60er/70er-Jahre) ist Vorsicht angebracht, da diese problematische Farbstoffe wie Cadmium enthalten könnten. Unbehandeltes Holzspielzeug dagegen gilt als unproblematisch, ebenso relativ modernes Hartplastik bekannter Marken (z.B. LEGO-Steine ab den 1990ern), das meist aus geprüftem ABS-Kunststoff besteht.
-
Zustand des Spielzeugs: Achten Sie darauf, ob das alte Spielzeug Abnutzungserscheinungen zeigt. Abgeblätterte Farbe, rissiger oder klebriger Kunststoff und bröckelndes Gummi sind Warnsignale – hier könnten Schadstoffe austreten. Ein ehemals weiches Plastikspielzeug, das inzwischen hart und spröde geworden ist, hat seine Weichmacher schon verloren (oder das meiste davon) – doch die sind dann womöglich in Ihrer Umgebung gelandet (Hausstaub, etc.). Generell gilt: Ist ein Material sichtbar gealtert oder beschädigt, sollte es nicht mehr in Kinderhände gelangen.
-
Geruchs- und Sichttest: Nutzen Sie Ihre Sinne. Riecht das Spielzeug stark chemisch oder unangenehm, lassen Sie lieber die Finger davon. Ein stechender Plastikgeruch kann auf ausdünstende Weichmacher oder Lösungsmittel hindeuten. Schauen Sie auch genau hin: Eine schlechte Verarbeitung (unschöne Nähte, schief aufgedruckte Bilder, Grate am Kunststoff) deutet darauf hin, dass keine hohe Qualitätskontrolle stattgefunden hat. Wenn offensichtliche Mängel übersehen wurden, wurden vermutlich auch bei der chemischen Sicherheit keine hohen Maßstäbe angelegt. Solche Produkte tauchen häufig als Billigimporte auf Online-Marktplätzen auf – insbesondere Ware aus Nicht-EU-Ländern ist oft mangelhaft geprüft.
-
Seriosität und Siegel: Beim Second-Hand-Kauf ist es schwierig, auf Prüfsiegel zu achten, da ältere Spielsachen solche Kennzeichnungen selten hatten oder diese verblasst sind. Bei neueren Artikeln helfen anerkannte Siegel wie das GS-Zeichen (“Geprüfte Sicherheit”), das auf geprüfte Schadstofffreiheit nach geltendem Recht hinweist. Doch Vorsicht: Entscheidend ist immer, nach dem Datum der Zertifizierung zu schauen. Ein Spielzeug, das z.B. im Jahr 2000 ein GS-Siegel erhielt, erfüllt die damaligen Grenzwerte – aber wichtige Verbote (wie das Phthalat-Verbot 2005) galten noch nicht. Das Siegel sagt also nichts über seitdem verbotene Altchemikalien aus. Das CE-Zeichen allein bietet keine Gewähr – es ist nur eine Eigenerklärung des Herstellers. Im Zweifel lohnt es sich, nach Herstellerinformationen zu recherchieren oder den Hersteller anzuschreiben, wenn man Genaueres über ein älteres Spielzeug wissen will.
-
Reinigung und Hygiene: Aus infektiologischer Sicht kann altes Spielzeug meist einfach gereinigt werden. Kunststoff lässt sich abwaschen, Stofftiere kann man heiß waschen. Keime sind also selten ein wirkliches Problem beim geerbten Spielzeug – die chemische Belastung ist das wichtigere Kriterium. Durch gründliches Reinigen können Sie immerhin Oberflächenschmutz und eventuelle Staubablagerungen entfernen, in denen sich z.B. abgelöste Partikel von Schadstoffen befinden könnten.
Fazit: Altes Spielzeug weiterzuverwenden ist nachhaltig und spart Geld – doch Eltern sollten abwägen. Handelt es sich um ein retro Holzpuzzle oder ein Stofftier aus der Jugend, spricht nach Reinigung kaum etwas dagegen. Bei antikem Plastikspielzeug oder grell lackierten Figuren hingegen ist Vorsicht geboten: Diese „Altlasten“ können gesundheitsgefährdende Chemikalien enthalten, die heute streng reguliert oder verboten sind. Im Zweifel gilt: Lieber sicher gehen und im Kinderzimmer auf Nummer sicher setzen – zum Wohl der Gesundheit der Kleinen. So bleibt das Spielen sorgenfrei und ungetrübt, egal ob das Spielzeug neu oder gebraucht ist.