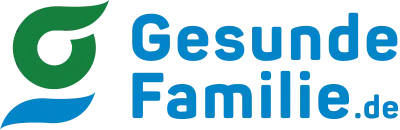Stickstoffoxide – was du über NO₂, seine Gefahren und gesundheitlichen Auswirkungen wissen solltest
Stickstoffoxide gehören zu den unsichtbaren Luftschadstoffen, die uns täglich umgeben. Besonders Kinder, Schwangere und Menschen mit Allergien oder Asthma fragen sich besorgt, wie gefährlich diese Gase sind. In diesem Ratgeber erfährst du auf sachliche und einfühlsame Weise, was es mit Stickstoffoxiden – vor allem Stickstoffdioxid (NO₂) – auf sich hat, welche Gesundheitsrisiken bestehen und wie du deine Familie schützen kannst. Lass uns gemeinsam verstehen, warum saubere Luft so wichtig für dich und deine Lieben ist.
 Abbildung: der Straßenverkehr (insbesondere Diesel-Abgase) gilt als Hauptquelle für Stickstoffoxide in der Außenluft
Abbildung: der Straßenverkehr (insbesondere Diesel-Abgase) gilt als Hauptquelle für Stickstoffoxide in der Außenluft
Was sind Stickstoffoxide (NO und NO₂)?
Stickstoffoxide (NOₓ) sind gasförmige Verbindungen aus Stickstoff (N) und Sauerstoff (O). Die beiden wichtigsten Vertreter sind Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO₂). NO entsteht bei Verbrennungsprozessen und wandelt sich in der Luft schnell zum giftigeren NO₂ um. Stickstoffdioxid selbst ist ein rotbraunes, stechend riechendes Reizgas. Es wirkt weitaus schädlicher auf unseren Körper als NO, weshalb NO₂ im Fokus von Luftreinhaltemaßnahmen steht.
In der Atmosphäre reagieren Stickstoffoxide weiter: NO₂ trägt zur Bildung von sekundären Schadstoffen wie Ozon (Sommersmog) und Feinstaub bei. Diese Folgeprodukte können die gesundheitlichen Auswirkungen noch verstärken. Insgesamt gehören Stickstoffoxide zu den bedeutendsten Luftschadstoffen unserer Zeit.
Wo kommen Stickstoffoxide vor?
Stickstoffoxide entstehen überall dort, wo Verbrennung stattfindet. Hauptquelle im Freien ist der motorisierte Straßenverkehr, vor allem Dieselmotoren, die überproportional NOₓ ausstoßen. Autos, LKW und Busse setzen große Mengen Stickstoffmonoxid (NO) frei, das dann rasch zu NO₂ oxidiert. Daneben tragen auch Kraftwerke, Industrieanlagen und Heizungen (z.B. Öl- oder Gasheizungen) zur NO₂-Belastung der Außenluft bei.
Aber auch in Innenräumen kann NO₂ zum Problem werden. Hier stammt es vor allem von Gasherden oder Gasöfen beim Kochen und Heizen sowie von Tabakrauch. So können durch Kochen mit einem Gasherd oder Rauchen in der Wohnung kurzfristig sehr hohe NO₂-Konzentrationen auftreten – vergleichbar mit stark belasteter Außenluft. Zum Glück sinken diese Werte bei guter Lüftung schnell wieder ab. Wenn jedoch in Innenräumen nicht gelüftet wird, können sich die Schadstoffe anreichern. Deshalb ist Frischluftzufuhr zuhause wichtig, besonders wenn du einen Gasherd nutzt oder jemand in der Wohnung raucht.
Natürliche Quellen von Stickstoffoxiden gibt es ebenfalls (z.B. bei Blitzschlag oder Vulkanausbrüchen), doch sie spielen im Vergleich zu den vom Menschen verursachten Emissionen eine untergeordnete Rolle. In Städten stammt der überwiegende Teil des NO₂ in der Luft aus Verkehr und anderen vom Menschen betriebenen Verbrennungsprozessen.
Wie wirken Stickstoffoxide auf die Gesundheit?
Stickstoffdioxid (NO₂) greift vor allem die Atemwege an. Es ist ein ätzendes Reizgas, das die Schleimhäute von Nase bis Lunge schädigen kann. NO₂ wirkt stark oxidativ, löst also in den Atemwegen Entzündungsreaktionen aus und verstärkt die reizende Wirkung anderer Schadstoffe. Schon eine kurzfristige hohe NO₂-Belastung kann zu akuten Beschwerden führen – etwa Atemnot, Husten oder Bronchitis. Wiederholen sich solche Belastungsspitzen, drohen langfristig chronische Atemwegs- und Lungenerkrankungen wie chronische Bronchitis oder Asthma. Entzündungsprozesse durch NO₂ können zudem die Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen erhöhen und die Lungenfunktion mindern.
Besonders heimtückisch: Durch die anhaltende Reizung und Schädigung der Atemwege steigt auch das Risiko für Allergien – etwa Heuschnupfen oder allergisches Asthma. NO₂ macht sozusagen die Atemwege überempfindlich. Wissenschaftler nennen das eine Hyperreagibilität der Bronchien, welche als Risikofaktor für die Entwicklung von allergischen Atemwegserkrankungen gilt. Verschiedene Studien weisen außerdem darauf hin, dass NO₂ die Allergenität von Pollen erhöhen kann – Pollen werden also aggressiver für unser Immunsystem. Das könnte erklären, warum Menschen in NO₂-belasteten Gegenden häufiger und stärker unter Heuschnupfen leiden. Hast du Allergien, kann schlechte Luftqualität deine Beschwerden deutlich verschlimmern.
Nicht nur die Lunge leidet: Bei hohen NO₂-Konzentrationen werden vermehrt Asthmaanfälle ausgelöst und es kommt zu mehr Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegserkrankungen. Sogar das Herz-Kreislauf-System bleibt nicht verschont – Studien zeigen einen Anstieg von Herzinfarkten und Schlaganfällen bei starker NO₂-Belastung. Langfristig kann Luftverschmutzung mit NO₂ die Sterblichkeit in der Bevölkerung erhöhen, insbesondere weil NO₂ indirekt auch zu mehr Feinstaub und Ozon führt (die ebenfalls lebensverkürzend wirken).
Besonders gefährdete Gruppen
Manche Menschen sind durch Stickstoffoxide besonders verwundbar. Wenn du zur Zielgruppe dieser Seite gehörst – also Eltern, (werdende) Mütter/Väter oder Allergiker – betrifft dich das direkt. Hier ein Blick auf die wichtigsten Risikogruppen:
Kinder: Kinder atmen mehr Luft pro Kilogramm Körpergewicht ein als Erwachsene und nehmen dadurch verhältnismäßig mehr Schadstoffe auf. Ihre Lungen und Immunsysteme befinden sich noch in der Entwicklung, weshalb Schadstoffe tiefgreifendere Auswirkungen haben können. NO₂ in der Umwelt wirkt sich nachweislich negativ auf die Gesundheit von Kindern aus. So wurde in einer großen Meta-Studie ein deutlich erhöhtes Asthma-Risiko festgestellt: Waren Kinder langfristig über 30 µg/m³ NO₂ ausgesetzt, stieg ihr Risiko, Asthma zu entwickeln, um rund 48 %. Auch die Lungenentwicklung kann leiden. Kinder, die nahe an viel befahrenen Straßen aufwachsen, zeigen ein geringeres Lungenwachstum und eine verringerte Lungenfunktion im Schulalter. Außerdem werden bei hoher Luftbelastung mehr Mittelohrentzündungen und Infekte beobachtet, da NO₂ die Abwehrkräfte der Atemwege schwächt. Kurz gesagt: Kinder reagieren empfindlicher – sie husten mehr, keuchen schneller und erkranken häufiger an Atemwegsleiden, wenn die Luft verschmutzt ist.
Schwangere & Ungeborene: In der Schwangerschaft bedeutet Luftverschmutzung doppeltes Risiko – für die Mutter und das ungeborene Kind. Stickstoffdioxid gelangt über die Lunge der Mutter in ihren Blutkreislauf und kann so indirekt auch das Baby beeinflussen. Studien legen nahe, dass hohe NO₂-Belastungen während der Schwangerschaft die Entwicklung des Fötus beeinträchtigen können. Zum Beispiel wurde beobachtet, dass bei werdenden Müttern in stark belasteten Gebieten häufiger Kinder mit niedrigem Geburtsgewicht zur Welt kommen. In einer US-Studie stieg das Risiko für ein sehr geringes Geburtsgewicht sogar um ein Vielfaches, wenn die Mütter höheren NO₂-Konzentrationen ausgesetzt waren. Auch Frühgeburten werden mit Luftschadstoffen in Verbindung gebracht. Zwar sind die genauen Ursachen noch nicht vollständig verstanden, aber man vermutet, dass anhaltende Entzündungen und oxidativer Stress durch Schadstoffe die Versorgung des Babys in der Gebärmutter verschlechtern. Als schwangere Frau merkst du NO₂-Belastung vielleicht durch vermehrte Atemwegsreizungen; die eigentliche Gefahr liegt aber darin, dass dein Baby evtl. mit weniger Geburtsgewicht oder unreiferer Lunge startet. Deshalb: Saubere Luft ist in der Schwangerschaft besonders wichtig – für dich und dein Kind.
Allergiker und Asthmatiker: Wenn du oder deine Kinder unter Asthma oder Allergien (z.B. Heuschnupfen) leiden, können Stickstoffoxide bestehende Beschwerden deutlich verschärfen. NO₂ reizt die bereits empfindlichen Bronchien und kann akute Asthmasymptome auslösen: Betroffene berichten von Atemnot, pfeifender Atmung und Husten, wenn sie dieseligen Abgasen ausgesetzt sind. Hohe NO₂-Werte können Asthmaanfälle provozieren und die Krankheit insgesamt schlechter kontrollierbar machen. Laut Umweltbundesamt war in Deutschland im Jahr 2014 etwa 14 % aller Asthmaerkrankungen auf die chronische NO₂-Belastung zurückzuführen – ein erstaunlich hoher Anteil. Auch Allergiker spüren die Unterschiede in der Luftqualität: Bei stark belasteter Luft treten häufigere und heftigere allergische Reaktionen auf. NO₂ kann die Schleimhäute so empfindlich machen, dass bereits kleinste Mengen Pollen oder Hausstaub zu Niesen, Augenreizungen oder Asthma führen. Zudem, wie oben erwähnt, kann NO₂ Pollen aggressiver machen und so Heuschnupfen verschlimmern. Für Allergiker-Asthmatiker-Familien bedeutet das: Ein Ausflug an einer vielbefahrenen Straße entlang kann schnelles Griff zum Inhalator nötig machen. Umso mehr lohnt es sich, auf Luftqualität zu achten und Schutzmaßnahmen zu ergreifen (dazu gleich mehr).
Ältere und Personen mit Vorerkrankungen (ergänzend): Auch wenn diese Gruppe nicht zur Kernzielgruppe „junge Familie” zählt, sei erwähnt, dass Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen (COPD, chronische Bronchitis) oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen besonders unter NO₂ leiden. Bereits vorgeschädigte Atemwege reagieren stärker auf jeden Reiz. Die Kombination von Feinstaub, NO₂ und Ozon an Hitzetagen kann für empfindliche Personen lebensgefährlich werden (Stichwort: Smogalarm). Falls etwa Großeltern oder andere Risikopersonen in eurem Haushalt leben, sollte man auf ihre Mitexposition ebenfalls achten.
Zusammengefasst: Stickstoffoxide betreffen uns alle, aber Kinder, Ungeborene, Asthmatiker und Allergiker sind am stärksten gefährdet. Die Entwicklung junger Körper kann durch NO₂ beeinträchtigt werden, und bereits bestehende Gesundheitsprobleme können sich verschlimmern. Deshalb sind strengere Grenzwerte und Schutzmaßnahmen in diesem Bereich so bedeutsam.
Welche Grenzwerte gelten für NO₂ (laut WHO, UBA etc.)?
Um die Bevölkerung vor den Gefahren von Stickstoffdioxid zu schützen, wurden Richt- und Grenzwerte festgelegt. In der EU (und Deutschland) gilt derzeit ein jährlicher Grenzwert von 40 µg/m³ NO₂ im Jahresmittel. Das heißt, im Durchschnitt eines Jahres sollte die NO₂-Konzentration 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht überschreiten. Dieser Wert lehnt sich an ältere Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation an. Daneben gibt es einen 1-Stunden-Grenzwert von 200 µg/m³, der im Jahr an höchstens 18 Stunden überschritten werden darf. Diese Grenzwerte sind seit 2010 verbindlich und noch immer in Kraft. Viele Jahre wurden sie in städtischen Ballungsräumen regelmäßig überschritten – erst 2024 konnte Deutschland erstmals flächendeckend die NO₂-Grenzwerte einhalten (aufgrund von Luftreinhaltemaßnahmen und modernerer Fahrzeugtechnik).
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat jedoch aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse deutlich strengere Richtwerte empfohlen. 2021 senkte die WHO ihren empfohlenen Jahresmittelwert für NO₂ von früher 40 µg/m³ auf nur noch 10 µg/m³. Außerdem empfiehlt die WHO einen Tagesmittelwert (24-Stunden-Mittel) von höchstens 25 µg/m³ NO₂. Diese Verschärfung trägt dem Umstand Rechnung, dass Gesundheitsrisiken schon bei weit niedrigeren Konzentrationen auftreten, als man früher angenommen hatte. Werte, die man früher für “sicher” hielt, erwiesen sich im Licht neuer Studien als noch zu hoch. Mit anderen Worten: Laut WHO ist schon eine dauerhafte NO₂-Belastung oberhalb von 10 µg/m³ kritisch für die Gesundheit aller Menschen – insbesondere der empfindlichen Gruppen.
Das Umweltbundesamt (UBA) als deutsche Fachbehörde unterstützt diese Empfehlungen der WHO und betont, dass die aktuellen gesetzlichen Grenzwerte von 40 µg/m³ veraltet sind. Die EU reagiert mittlerweile: Ab 2030 sollen europaweit verschärfte Grenzwerte gelten. Ein neuer NO₂-Jahresgrenzwert von 20 µg/m³ ist vorgesehen, um näher an die WHO-Empfehlungen heranzukommen. Diese Anpassung ist Teil der überarbeiteten EU-Luftqualitätsrichtlinie, die Ende 2024 beschlossen wurde. Zwar ist selbst 20 µg/m³ noch doppelt so hoch wie der WHO-Richtwert – aber es wäre ein großer Schritt in Richtung sauberere Luft. Für uns Bürger heißt das: Was heute formal “noch im Rahmen” ist, könnte in Zukunft als zu hoch gelten.
Zum Verständnis der Werte: Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) ist die Maßeinheit für die Konzentration eines Schadstoffs in der Luft. 40 µg/m³ NO₂ entsprechen z.B. grob 21 ppb (Teilen pro Milliarde) in Volumeneinheiten. In Innenräumen ohne eigene Quellen liegen die NO₂-Werte etwa bei der Hälfte der Außenluft-Konzentration. Doch beim Kochen mit Gas oder Rauchen können indoor kurzfristig Hunderte µg/m³ erreicht werden – was die Bedeutung guter Belüftung zeigt.
Fazit zu den Grenzwerten: Je niedriger, desto besser für die Gesundheit. Die offiziellen Grenz- und Richtwerte bieten Anhaltspunkte, sind aber keine scharfe Grenze zwischen “sicher” und “gefährlich”. Auch unterhalb der Grenzwerte können bereits gesundheitliche Schäden auftreten – vor allem bei empfindlichen Personen. Deshalb lohnt es sich, die eigene Belastung so gering wie möglich zu halten, auch wenn die gesetzlichen Limits eingehalten werden.
Wie kannst du dich und deine Familie schützen?
Auch wenn wir die Außenluft nicht immer direkt beeinflussen können, bist du den Stickstoffoxiden nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt viele praktische Maßnahmen, mit denen du die NO₂-Belastung für dich und deine Familie reduzieren kannst. Hier einige Tipps, was du tun kannst:
-
Frische Luft nutzen: Lüfte deine Wohnung regelmäßig strategisch. Am besten querlüften (Durchzug) für ein paar Minuten, wenn die Außenluft gerade relativ sauber ist. Vermeide es, direkt während der Hauptverkehrszeiten (Morgen- und Abendverkehr) ausgiebig zu lüften, wenn viele Abgase in der Luft sind. Ideal sind Zeiten mit wenig Verkehr oder nach einem Regenschauer (Regen wäscht Schadstoffe etwas aus der Luft). So holst du dir Sauerstoff ins Haus, ohne unnötig NO₂ hereinzulassen.
-
Innenraumquellen vermeiden: Verzichte möglichst auf Rauchen in der Wohnung – Tabakrauch erzeugt sehr hohe NO₂-Spitzen und schadet vor allem Kindern massiv (Passivrauch enthält viele Schadstoffe). Wenn ein Familienmitglied raucht, sollte es immer draußen tun. Gasherd-Nutzer sollten beim Kochen unbedingt die Dunstabzugshaube einschalten oder Fenster öffnen, um die Abgase sofort nach draußen zu befördern. Überlege langfristig, ob ein elektrischer Herd (Induktion) eine Alternative wäre – so entsteht gar kein NO₂ beim Kochen. Auch Kerzen oder offene Kamine nur in Maßen verwenden, da Verbrennung immer etwas NOₓ erzeugt. Innenraum-Schadstoffe hast du weitgehend selbst in der Hand – nutze diesen Vorteil!
-
Verkehrsbelastung reduzieren: Plane Alltagsrouten so, dass du und deine Kinder möglichst wenig direkt neben stark befahrenen Straßen unterwegs seid. Wenn möglich, wähle für den Spaziergang mit dem Kinderwagen eine Nebenstraße oder einen Parkweg statt der Hauptverkehrsstraße. Schon ein paar Meter Abstand von der Fahrbahn verringern die NO₂-Konzentration deutlich. Falls ihr an einer viel befahrenen Straße wohnt, ist es besser, in Räumen auf der abgewandten Seite zu lüften (sofern baulich machbar). Im Auto kannst du bei Stau und Tunnel die Lüftung auf Umluft stellen, damit du nicht die Abgase der vorausfahrenden Fahrzeuge ansaugst. Fahrradfahrer in der Stadt: Nutzt nach Möglichkeit Nebenrouten; tragt notfalls eine Feinstaubmaske, wenn die Luft sehr schlecht ist – sie kann zwar NO₂ nicht gut filtern, aber hält wenigstens Partikel zurück, die oft gleichzeitig mit NO₂ auftreten.
-
Technische Helfer: Überlege die Anschaffung eines Luftreinigers für die Wohnräume, vor allem wenn ein Familienmitglied Asthma hat. Geräte mit Aktivkohle-Filtern können neben Partikeln auch Gase wie NO₂ aus der Innenraumluft reduzieren. Wichtig ist, dass der Luftreiniger zur Raumgröße passt und regelmäßig der Filter gewechselt wird. Zwar können solche Geräte nicht alle Probleme lösen, aber sie verbessern die Raumluft spürbar. Ebenfalls hilfreich: Ein Luftgütemessgerät (Indoor-Air-Monitor), das CO₂ und evtl. NO₂ misst – so bekommst du ein Gefühl dafür, wie gut deine Lüftungsgewohnheiten sind und kannst bei schlechten Werten gegensteuern (lüften, Quelle abstellen etc.). Inzwischen gibt es auch Smartphone-Apps und städtische Webseiten, die die aktuelle Außenluftqualität anzeigen. Schau dort ruhig mal rein, bevor du mit dem Baby im Tragetuch zur Rush-Hour an der Hauptstraße spazieren gehst.
-
Grün schafft Linderung: Begrüne deine Umgebung, soweit es geht. Pflanzen filtern zwar NO₂ nur begrenzt, aber sie verbessern insgesamt das Mikroklima. Ein begrünter Innenhof oder Balkon kann Staub binden und etwas Abschirmung gegen die Straße bieten. Bäume entlang von Straßen reduzieren lokal die Schadstoffkonzentration und spenden Schatten (was Ozonbildung verringert). Natürlich können Zimmerpflanzen alleine keine Wunder bewirken, aber im Zusammenspiel mit regelmäßiger Lüftung tragen sie zu einem angenehmeren Raumklima bei.
-
Setze auf saubere Mobilität: Langfristig schützt du deine Familie am besten, indem du dich für eine verkehrsarme und emissionsarme Umgebung einsetzt. Jeder Beitrag zählt: Nutze öfter mal das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel statt das Auto – so reduzierst du selbst NO₂-Emissionen. Unterstütze lokale Initiativen für Tempo-30-Zonen, Dieselfahrverbote oder grüne Stadtplanung – all das führt zu weniger Abgasen in Wohngebieten. Vielleicht kannst du dich in der Schule oder Kita deines Kindes dafür starkmachen, dass Eltern nicht im laufenden Motor vor der Tür parken (Stichwort: Elterntaxi und Abgase direkt am Schultor). Solche Veränderungen kommen der ganzen Gemeinschaft zugute.
-
Achtsam bleiben, aber nicht ängstigen lassen: Informiere dich über die Luftqualität, aber lass dich nicht verrückt machen. Wenn die Werte mal erhöht sind, bedeutet das nicht sofort, dass ihr krank werdet – es geht um Wahrscheinlichkeiten und langfristige Risiken. Wichtig ist, das Thema ernst zu nehmen, ohne in Panik zu verfallen. Mit bewussten Entscheidungen im Alltag kannst du schon sehr viel bewirken. Und je mehr Leute mitmachen (Politik, Gesellschaft), desto sauberer wird die Luft für uns alle werden.
Zum Schluss: Die Tatsache, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst, ist bereits ein großer Schritt. Du sorgst dich um die Gesundheit deiner Familie – und Wissen ist der erste Schlüssel, um sie zu schützen. Achte auf eure Atemluft, beherzige ein paar der obigen Tipps und bleib engagiert. Saubere Luft ist ein Gut, für das es sich einzusetzen lohnt – für dich, deine Kinder und die kommenden Generationen.
Quellenangaben
- Umweltbundesamt (UBA): Gesundheitliche Wirkungen von Stickstoffdioxid – Hintergrundinformationen zu NO₂ als Reizgas und seinen Effekten.
- Weltgesundheitsorganisation (WHO): Global Air Quality Guidelines 2021 – Empfohlene Grenzwerte für NO₂ (10 µg/m³ jährlich, 25 µg/m³ täglich).
- Deutsche Studien und Stellen: GPA** – Kinderärzte und Umweltmediziner: NO₂ erhöht Asthma-Risiko bei Kindern deutlich; UBA-Studie 2018 – NO₂-Attributionsanteile an Krankheiten (u.a. ~14% der Asthmafälle).
- Schwangerschaft: Studie Rich et al. 2009 (USA) – Zusammenhang zwischen NO₂-Exposition und niedrigem Geburtsgewicht.
- Allergien: Antwort Bundesregierung 2018 – NO₂ macht Pollen aggressiver und steigert Allergierisiko.
- Innenraumluft: UBA-Umid 1/2020 – Stickstoffdioxid im Innenraum, Hinweise zu Gasherden, Rauchen und Lüftungsverhalten.
- UNICEF/HEI-Bericht 2023: Luftverschmutzung und Kinder – weltweit ~700.000 Todesfälle <5 J. in 2021 durch Luftverschmutzung; Kinder atmen mehr Schadstoffe pro KG.
(Alle Links zuletzt abgerufen am 20.05.2025)