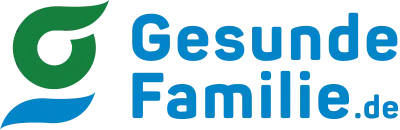Radon – unsichtbares Umweltgift und Gesundheitsrisiko für deine Familie
Radon – du kannst es weder sehen, riechen noch schmecken, doch dieses radioaktive Gas kann in deinem Zuhause lauern. Es entsteht natürlicherweise im Erdreich und kann sich in geschlossenen Räumen ansammeln, wo es zum gesundheitlichen Risiko wird. Gerade junge Familien, werdende Eltern und auch Allergiker-Familien sollten über diese unsichtbare Gefahr Bescheid wissen, um ihr Zuhause sicher und gesund zu halten.
 Symbolbild: Radon ist ein unsichtbares Gas.
Symbolbild: Radon ist ein unsichtbares Gas.
Was ist Radon?
Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Edelgas. Es entsteht beim radioaktiven Zerfall von Uran, das in fast allen Böden und Gesteinen zu finden ist. Das Besondere: Radon ist unsichtbar, geruchlos und geschmacklos – ohne technische Messgeräte kannst du es nicht wahrnehmen. Im Freien ist das meist unproblematisch, denn draußen verdünnt sich Radon rasch auf sehr niedrige Konzentrationen (in Deutschland etwa 5–30 Bq/m³). In Innenräumen jedoch kann sich Radon anreichern und zum ernsthaften Problem werden.
Obwohl Radon natürlichen Ursprungs ist, trägt es erheblich zur alltäglichen Strahlenbelastung bei. Tatsächlich macht Radon den größten Anteil der natürlichen Radioaktivität aus, der wir ausgesetzt sind. Mit anderen Worten: Wir alle atmen täglich geringe Mengen Radon ein – normalerweise in ungefährlichen Dosen. Problematisch wird es erst, wenn sich Radon in Innenräumen auf höhere Werte konzentriert.
Radonbelastung in Innenräumen
Radon zählt zu den Schadstoffen in der Innenraumluft, die oft unterschätzt werden. Das Gas entsteht tief unter deinen Füßen und steigt kontinuierlich aus dem Boden auf. Findet es einen Weg ins Innere eines Gebäudes – etwa durch Risse im Fundament, undichte Stellen an Rohrleitungen oder durch offene Kellerräume – kann es sich dort ansammeln. Besonders in Kellern und Erdgeschossen können erhöhte Radon-Konzentrationen auftreten. Je dichter ein Haus gebaut ist und je schlechter es durchlüftet wird, desto leichter kann sich Radon in der Raumluft anreichern.
Ein gut isoliertes Zuhause ist zwar energieeffizient, aber ohne regelmäßiges Lüften kann es Radon buchstäblich einschließen. Wenn du z. B. aus Sorge vor Pollen (etwa bei Heuschnupfen) oder aus anderen Gründen selten lüftest, hältst du zwar manche Schadstoffe draußen – doch Radon kann sich drinnen ungestört aufbauen. Auf diese Weise kann schlechte Lüftung die Radonbelastung in deinen vier Wänden erhöhen, ohne dass du es merkst.
Wichtig zu wissen ist, dass Radon in jeder Region vorkommen kann, jedoch nicht überall gleich stark. Ob ein Gebäude viel Radon abbekommt, hängt von der Beschaffenheit des Bodens (Urangehalt, Durchlässigkeit) und vom Zustand des Gebäudes ab. Zwei benachbarte Häuser können daher unterschiedliche Radonwerte haben. Du kannst also nicht allein vom Wohnort darauf schließen, wie hoch die Radonbelastung in deinem Haus ist – dafür müsste man konkret messen (mehr zu Messmethoden und Schutz erfährst du in einem anderen Beitrag).
Radon: Auswirkungen auf die Gesundheit
Warum all die Sorge um ein Gas, das man gar nicht sieht? Die Antwort liegt in der radioaktiven Strahlung, die Radon und seine Zerfallsprodukte im Körper abgeben. Atmest du radonhaltige Luft ein, gelangen winzige radioaktive Partikel in deine Atemwege. Diese Partikel setzen dort Alpha-Strahlung frei, welche die Zellen in der Lunge schädigen kann. Die Folgen zeigen sich erst nach Jahren: Langfristig erhöht Radon das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.
Lungenkrebs ist die mit Abstand wichtigste bekannte Gesundheitsgefahr durch Radon. Laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) gehört Radon nach dem Rauchen zu den häufigsten Ursachen für Lungenkrebs. Etwa 6 von 100 Lungenkrebs-Todesfällen in Deutschland (rund 2.800 Fälle pro Jahr) sind auf Radon in Wohnräumen zurückzuführen. Diese Zahl ist alarmierend – sie zeigt, dass Radon kein Nischenthema ist, sondern Tausende Familien betrifft. Zum Vergleich: Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass zwischen 3 % und 14 % aller Lungenkrebserkrankungen weltweit auf Radon zurückgehen, je nach Land und Raucheranteil.
Wie stark Radon dein persönliches Krebsrisiko erhöht, hängt vor allem von zwei Faktoren ab: der Höhe der Radon-Konzentration und der Dauer der Exposition. Vereinfacht gesagt: Je höher die Radonbelastung und je länger du ihr ausgesetzt bist, desto größer wird das Risiko. Dabei gibt es keinen bekannten Schwellenwert, unterhalb dessen Radon garantiert ungefährlich wäre. Selbst vergleichsweise niedrige Konzentrationen können über Jahre hinweg Schaden anrichten – das Risiko steigt nach aktuellen Erkenntnissen linear mit der Dosis. Deshalb ist es sinnvoll, jede unnötige Radonexposition zu vermeiden.
Ein beunruhigender Aspekt von Radon ist, dass man die Auswirkungen nicht sofort spürt. Radon verursacht keine akuten Symptome. Anders als etwa Kohlenmonoxid, das schnell zu Übelkeit und Schwindel führt, merkst du von Radon im Alltag nichts. Die Schäden entstehen schleichend und bleiben oft unbemerkt, bis viele Jahre später eine Krebserkrankung diagnostiziert wird. Diese Verzögerung macht es so wichtig, Radon ernst zu nehmen, bevor es zu spät ist.
Wer ist besonders gefährdet?
Radon betrifft prinzipiell jeden – aber einige Personengruppen und Umstände erhöhen das Risiko noch zusätzlich:
-
Raucher: Tabakrauchen und Radon zusammen sind eine gefährliche Mischung. Radon-belastete Luft richtet bei Rauchern weitaus größeren Schaden an, da ihre Lunge bereits vorgeschädigt und empfindlicher ist. Studien zeigen, dass Raucher ein etwa 25-fach höheres Risiko durch Radon haben als Nichtraucher. Die beiden Risikofaktoren verstärken sich gegenseitig, was Lungenkrebs noch wahrscheinlicher macht.
-
Kinder: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen – ihr Körper reagiert sensibler auf Schadstoffe. Ihre Lungen befinden sich noch im Wachstum, und sie atmen schneller, wodurch sie relativ mehr Radon aufnehmen können. Zudem haben sie eine längere Lebenszeit vor sich, in der sich mögliche Schäden entwickeln könnten. Wissenschaftliche Analysen deuten darauf hin, dass eine Radon-Exposition in jungen Jahren das spätere Lungenkrebsrisiko stärker erhöhen kann als die gleiche Exposition in höherem Alter.
-
Schwangere: In der Schwangerschaft ist man besonders vorsichtig – zurecht, denn Embryo und Fötus reagieren empfindlich auf schädliche Einflüsse. Zwar wirkt Radon vor allem auf die Lunge der Mutter, doch jede unnötige Strahlenbelastung in dieser Phase sollte vermieden werden. Erste Studien untersuchen sogar, ob Radon neben der Lunge noch andere Gesundheitsbereiche beeinflussen kann. So gibt es Hinweise, dass hohe Radonwerte das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes erhöhen könnten. Ein solcher Zusammenhang ist noch nicht endgültig bewiesen, aber allein die Möglichkeit zeigt, wie weitreichend Radons Einfluss auf die Gesundheit sein könnte. Für werdende Eltern ist Radon daher ein Thema, das man im Blick haben sollte. Mehr dazu erfährst du in unserem Artikel über Radon und Schwangerschaftsdiabetes.
-
Wohnorte in Radonhochgebieten: Schließlich spielt auch dein Wohnort eine Rolle. In bestimmten Regionen – etwa in Mittelgebirgs- und Alpenrandgebieten im Süden Deutschlands – ist die natürliche Radonkonzentration im Boden besonders hoch. Bewohner solcher Gegenden haben ein höheres Risiko, dass in ihren Häusern überdurchschnittliche Radonwerte gemessen werden. Das bedeutet nicht automatisch Gefahr, aber es erfordert Aufmerksamkeit. Umgekehrt haben Gegenden mit weniger Uran im Boden, wie viele norddeutsche Regionen, tendenziell geringere Radonwerte. Dennoch gilt: Jede Wohnung kann individuell anders sein.
Regionale Unterschiede der Radonbelastung
Die Radonbelastung in Deutschland variiert stark je nach geografischer Lage. Im Durchschnitt liegt die Radon-Konzentration in deutschen Wohnräumen bei etwa 65 Bq/m³. Dieser Wert ergibt sich aus einer großen Zahl von Messungen im gesamten Bundesgebiet. Doch dieser Mittelwert täuscht über die Spannweite hinweg: Während in einigen Gebieten – zum Beispiel im Norden und Nordwesten – teils unter 35 Bq/m³ gemessen wurden, erreichen andere Regionen – vor allem in den Mittel- und Hochgebirgen Süddeutschlands – über 150 Bq/m³ im Durchschnitt.
Eine vom BfS veröffentlichte Radon-Karte zeigt, wo die Belastung tendenziell höher ist. Daraus geht hervor, dass insbesondere Bundesländer wie Thüringen und Sachsen höhere Durchschnitte in Wohnräumen aufweisen – hier liegt der Anteil der radonbedingten Lungenkrebsfälle denn auch am höchsten (rund 10 % aller Lungenkrebs-Todesfälle in Thüringen). Dagegen sind Stadtstaaten wie Berlin oder Hamburg aufgrund ihrer Bodenzusammensetzung weniger betroffen (nur ca. 3 % der Lungenkrebs-Todesfälle). Aber Vorsicht: Regionalwerte sind Durchschnittswerte. Es kann auch in einer “niedrigen” Region einzelne Häuser mit hohen Werten geben – und umgekehrt.
Erschreckend ist die Schätzung, wie viele Menschen hierzulande erhöhten Radonwerten ausgesetzt sind. Laut BfS wohnen etwa 10,5 Millionen Menschen in Deutschland in Häusern, die über 100 Bq/m³ Radon aufweisen. Bei knapp 2 Millionen Menschen liegt die Belastung sogar über 300 Bq/m³ – also oberhalb des Referenzwertes, ab dem in Deutschland Maßnahmen zum Schutz empfohlen werden. Vereinzelt wurden in Wohnhäusern sogar extreme Werte von über 1.000 Bq/m³ gemessen. Solche Zahlen machen deutlich, dass Radon kein fernes Problem einiger weniger Orte ist, sondern potenziell Millionen von Haushalten betrifft.
Radon – eine oft unterschätzte Gefahr
Für viele Menschen ist Radon noch ein unbekannter Begriff. Gerade deshalb wird die Gefahr leicht unterschätzt. Das radioaktive Gas kommt lautlos und unsichtbar daher, verursacht keine unmittelbaren Beschwerden und bleibt so oft jahrelang unbemerkt. Doch die wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen eine klare Sprache: Radon ist ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko – insbesondere in Innenräumen. Wer ein gesundes Zuhause für sich und seine Familie möchte, sollte Radon als möglichen Risikofaktor auf dem Schirm haben.
Die gute Nachricht ist, dass du der Radon-Gefahr nicht hilflos ausgeliefert bist. Es gibt wirksame Möglichkeiten, Radon zu messen und falls nötig zu reduzieren. Wichtig ist zunächst, Bescheid zu wissen: Wenn du dir der unsichtbaren Gefahr bewusst bist, kannst du informierte Entscheidungen treffen. Radon mag unsichtbar sein, aber das Wissen darüber hilft dir, dein Zuhause für dich, deine Kinder und alle Familienmitglieder ein Stück sicherer zu machen.