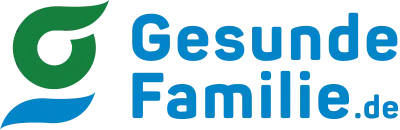Mikroplastik im Trinkwasser: Was du wissen solltest
Mikroplastik gelangt bis in unser Leitungswasser – wenn auch meist in winziger Konzentration und unsichtbarer Form.
 Mikroplastik-Partikel sind mikroskopisch klein. Aktuelle Filtersysteme können die allerkleinsten Teilchen oft nicht vollständig zurückhalten.
Mikroplastik-Partikel sind mikroskopisch klein. Aktuelle Filtersysteme können die allerkleinsten Teilchen oft nicht vollständig zurückhalten.
Mikroplastik – das sind winzige Kunststoffteilchen, kleiner als 5 Millimeter, oft sogar nur Mikrometer groß – ist heutzutage überall zu finden. In den letzten Jahren haben Forschende selbst in entlegenen Regionen und im menschlichen Körper Mikroplastik nachgewiesen. Verständlich, dass man sich Sorgen macht, ob es sogar im Trinkwasser landet und der Gesundheit schadet – besonders wenn du eine junge Familie hast, schwanger bist oder unter Allergien leidest. In diesem Artikel erfährst du aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Mikroplastik im Trinkwasser in Deutschland, offizielle Einschätzungen und praktische Tipps, wie du dich und deine Familie schützen kannst.
Wie gelangt Mikroplastik ins Trinkwasser?
Mikroplastik entsteht vor allem, wenn größere Plastikteile zerfallen (sekundäres Mikroplastik) – zum Beispiel durch Abrieb von Autoreifen, Waschen von Kunstfaserkleidung oder Verwitterung von Plastikmüll. Auch gezielt hergestellte Kunststoffkügelchen (primäres Mikroplastik) wurden früher vielen Produkten wie Peelings beigemischt, sind aber in der EU inzwischen stark eingeschränkt. Die Folge: Winzige Plastikpartikel schweben überall in unserer Umwelt, in der Luft, im Boden, in Flüssen und Meeren – und so können sie letztlich auch ins Trinkwasser gelangen.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben tatsächlich Mikroplastik in Trinkwasserproben nachgewiesen. In einer vielbeachteten Studie wurden weltweit Leitungswasser-Proben analysiert: 72 % der Proben in Europa – darunter aus Deutschland – enthielten Mikropartikel. Als Quellen im Leitungswasser gelten vor allem:
- Luftgetragener Staub und Fasern: Partikel aus Textilfasern (von Kleidung, Teppichen etc.) schweben in der Raumluft und können ins Trinkwasser gelangen. Selbst winzige Fasern aus dem Wäschetrockner entweichen über die Lüftung in die Umgebungsluft und können sich auf Wasseroberflächen absetzen.
- Einträge aus der Umwelt: Mikroplastik, das etwa durch Reifenabrieb auf Straßen entsteht oder aus unsachgemäß entsorgtem Müll stammt, wird vom Regen in den Boden und ins Grundwasser gespült. Auch Flüsse und Seen enthalten Mikroplastik; bei der Trinkwassergewinnung aus Oberflächenwasser können in geringem Maße Partikel durchschlüpfen, wenn die Filter sie nicht vollständig zurückhalten.
- Rohrleitungen und Aufbereitung: Theoretisch können auch Kunststoffrohre, Dichtungen oder Filter in Wassersystemen minimal abriebbedingtes Mikroplastik ans Wasser abgeben. Bisherige Untersuchungen zeigen jedoch, dass die deutsche Trinkwasseraufbereitung sehr effektiv ist: Selbst falls Rohwasser Partikel enthält, werden diese in der Regel nahezu vollständig entfernt.
Mineralwasser in Flaschen ist ebenfalls betroffen: Hier stammt das Mikroplastik überwiegend von der Verpackung selbst. Plastikflaschen (meist PET) und ihre Verschlüsse können bei Abfüllung, Transport oder Öffnen kleinste Partikel abgeben. In Glasflaschen findet man zwar weniger Kunststofffasern, aber auch dort können z.B. Dichtungsringe im Deckel oder Kunststoffbeschichtungen minimale Partikel freisetzen. Eine Untersuchung berichtete in 93 % der getesteten Trinkwassermineralwässer Mikroplastikfunde, im Durchschnitt etwa 10 Partikel pro Liter (größer als 0,1 Millimeter). Eine weitere Studie fand im Wasser aus verschiedenen Flaschenarten (PET-Einweg, PET-Mehrweg, Glasflaschen, Getränkekartons) durchschnittlich ca. 14 Partikel pro Liter (größer als 5 µm). Zum Vergleich: Leitungswasser aus Grund- oder Oberflächenwasser ist Studien zufolge meist frei von nachweisbarem Mikroplastik oder allenfalls gering belastet – dazu weiter unten mehr.
Messmethoden: Wie wird Mikroplastik nachgewiesen?
Mikroplastik im Wasser zu messen ist eine technische Herausforderung. Die Teilchen sind oft so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht sieht. Wissenschaftler nutzen daher spezielle Filter- und Analyseverfahren, um Partikel einzufangen und zu identifizieren. Übliche Methoden sind zum Beispiel: Infrarot- und Raman-Mikrospektroskopie (dabei werden einzelne Partikel auf ihre Kunststoff-Art analysiert) sowie thermoanalytische Verfahren (dabei wird die Probe erhitzt, und man analysiert die entstehenden Gase, um Kunststoffe nachzuweisen).
Jede Methode hat ihre Grenzen. Optische Verfahren (Mikroskopie mit Spektroskopie) können Partikel ab etwa 10–20 µm Größe sicher erkennen, teils auch bis ~1 µm, aber darunter wird es schwierig. Thermoanalytische Methoden erfassen sogar Nanoplastik, liefern aber keine Info zur Partikelanzahl oder -größe. Eine einheitliche Standardmethode fehlte lange, weshalb Studien oft schwer vergleichbar waren. Die Vielfalt der Kunststoffarten, Formen und Größen macht die Analyse kompliziert. Zudem besteht immer das Risiko, Proben versehentlich mit Mikroplastik aus der Luft oder von Geräten zu kontaminieren – die Labors müssen extrem sauber arbeiten.
Erst 2024 hat die EU-Kommission reagiert und eine standardisierte Messmethodik beschlossen, um Mikroplastik in Trinkwasser europaweit vergleichbar zu erfassen. Damit werden Wasserwerke in Zukunft verpflichtet, systematisch Daten über Mikroplastik im Trinkwasser zu sammeln. In den bisher veröffentlichten Studien lagen die gemessenen Werte übrigens zwischen 0,0001 und 440 Partikeln pro Liter – eine enorme Spannbreite. Europäische Proben bewegen sich dabei eher am unteren Ende dieser Skala. Deutschlands Trinkwasser insbesondere schneidet sehr gut ab, wie gleich gezeigt wird.
Wie hoch ist die Mikroplastik-Belastung in Deutschland?
Die gute Nachricht vorweg: Dein Leitungswasser in Deutschland gehört zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln – es wird täglich geprüft und muss gesetzlichen Anforderungen genügen. Nach allem, was man bisher weiß, ist die Mikroplastik-Belastung im deutschen Trinkwasser extrem gering. Eine Expertin vom Technologiezentrum Wasser (TZW) fasst den aktuellen Kenntnisstand so zusammen: „Auf Basis von Literatur und aller uns vorliegenden Messdaten ist die Belastung des Trinkwassers in Deutschland mit Mikroplastik extrem niedrig, in der Regel nicht nachweisbar, und in jedem Fall deutlich geringer als die Belastung, der wir aus anderen Quellen ausgesetzt sind.“. Mit anderen Worten: Du nimmst über andere Wege viel mehr Mikroplastik auf – zum Beispiel über Haushaltsstaub in der Luft oder bestimmte Lebensmittel – als über das tägliche Glas Wasser aus dem Hahn.
Warum hört man dann überhaupt vom Mikroplastik im Trinkwasser? Zum einen, weil es prinzipiell nachweisbar ist – die oben genannten Studien haben gezeigt, dass überall auf der Welt gelegentlich Partikel im Wasser gefunden werden. Zum anderen, weil Wissenschaft und Behörden einen Vorsorgeansatz verfolgen: Sie wollen mögliche Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden. Deshalb laufen derzeit mehrere Forschungsprojekte, um auch die kleinsten Mengen Mikroplastik aufzuspüren. Beispielsweise startet 2025 ein deutsches Forschungsprojekt, das systematisch untersuchen will, ob und in welchem Umfang Mikroplastik in unseren Trinkwasserleitungen vorkommt. Bislang gibt es aber Entwarnung: Wo gemessen wurde, fand man kaum etwas. In früheren Untersuchungen konnten in aufbereitetem Leitungswasser teilweise gar keine Mikroplastik-Partikel nachgewiesen werden, weil die Konzentration unterhalb der Nachweisgrenze lag. Sollte überhaupt mal ein Partikel auftauchen, lässt sich oft nicht eindeutig klären, ob er wirklich aus dem Wassersystem stammt oder etwa bei der Probenahme aus der Luft kam.
Anders sieht es bei abgefülltem Mineralwasser aus. Hier wurden – wie oben erwähnt – in einem Großteil der Proben Mikroplastikpartikel gefunden. Die Werte sind zwar auch im Trinkwasser aus Flaschen meist sehr niedrig (einstellige Partikelzahlen pro Liter), aber im Vergleich zum Leitungswasser tendenziell höher. Vereinzelt können sie auch deutlich höher ausfallen: In einer Studie wurden in bestimmten Marken von Flaschenwasser mehr als 50 Millionen Partikel pro Liter nachgewiesen (inklusive Nanoplastik). Solche extremen Werte sind Ausnahmen und stammen vor allem von sehr kleinen Partikeln. Dennoch unterstreicht es, dass Plastikflaschen selbst eine wichtige Mikroplastik-Quelle sein können.
Einschätzungen von Behörden und Forschenden
Angesichts dieser Faktenlage betonen deutsche und internationale Behörden vor allem zweierlei: Erstens gibt es derzeit keine Hinweise, dass die winzigen Plastikmengen im Trinkwasser akute Gesundheitsgefahren auslösen. Zweitens muss weiter geforscht werden, um mögliche Langzeitrisiken auszuschließen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kam 2019 zu dem Schluss, dass keine verlässlichen Informationen vorliegen, die auf ein Gesundheitsrisiko durch Mikroplastik im Trinkwasser hindeuten. Gleichzeitig forderte die WHO mehr Untersuchungen – insbesondere zu noch kleineren Nanopartikeln und zur Frage, ob Mikroplastik Schadstoffe oder Keime transportieren kann.
Die deutschen Fachbehörden vertreten eine ähnliche Linie. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) etwa hat 2024 seinen Fragen-und-Antworten-Katalog zu Mikroplastik aktualisiert. Darin stellt das BfR fest, dass nach dem derzeitigen Stand des Wissens nicht davon auszugehen ist, dass Mikroplastik in Lebensmitteln (inklusive Trinkwasser) eine Gesundheitsgefahr für den Menschen darstellt. Mit anderen Worten: Bisher wurde kein Schaden nachgewiesen, und die aufgenommenen Mengen sind nach aktuellem Kenntnisstand sehr gering. Das bedeutet aber nicht, dass Mikroplastik harmlos ist – vielmehr sind viele Fragen noch offen. Das Umweltbundesamt (UBA) erklärt, die konkrete Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Mikroplastik lasse sich noch nicht abschätzen. Zwar gebe es erste Hinweise auf mögliche schädliche Wirkungen, doch fehlen belastbare Daten und standardisierte Untersuchungen. Weil Mikroplastik so unterschiedlich ist (Größe, Form, Kunststoffart, evtl. anhaftende Chemikalien) und Studien teils schwer vergleichbar sind, bestehen weiterhin Wissenslücken. Das UBA empfiehlt daher, die Exposition vorsorglich zu minimieren und die Forschung voranzutreiben.
Auch unabhängige Forschungsprojekte – etwa vom Helmholtz-Zentrum und Universitäten – beschäftigen sich intensiv mit dem Thema. In den letzten Jahren wurden Mikroplastikpartikel im menschlichen Blut, in der Lunge und sogar in Plazenten von Ungeborenen entdeckt. Das klingt alarmierend, doch ist bislang unklar, welche gesundheitlichen Folgen diese Partikel im Körper haben. Einige Laborstudien an Zellkulturen und Tieren zeigen, dass Mikroplastik Entzündungsreaktionen auslösen kann. Es gibt die Sorge, dass ständige Belastung mit Partikeln möglicherweise chronische Entzündungen oder andere Effekte begünstigt. Beweise für konkrete Krankheiten beim Menschen durch Mikroplastik stehen jedoch noch aus. Epidemiologische Studien (langfristige Bevölkerungsstudien) fehlen bislang.
Besonders im Blick: Kinder, Schwangere, Allergiker
Für vulnerable Gruppen wie Kinder und Schwangere stellt sich die Frage, ob sie besonders geschützt werden müssen. Hier heißt es derzeit ebenfalls: Entwarnung mit Vorbehalt. Babys und Kinder nehmen relativ mehr Wasser (und Nahrung) pro Körpergewicht zu sich als Erwachsene – theoretisch könnten sie also auch mehr Mikroplastikpartikel aufnehmen. Bis jetzt gibt es jedoch keine Hinweise, dass Mikroplastik Kindern direkt schadet. Allerdings haben Forscher erst kürzlich herausgefunden, dass sogar Neugeborene Mikroplastik im Stuhl ausscheiden, was bedeutet, dass sie bereits im Mutterleib und durch die Ernährung früh damit in Kontakt kommen. Mikroplastik wurde in einer Studie in Muttermilch gefunden und auch in Mutterkuchen (Plazenta), was die Dringlichkeit weiterer Untersuchungen unterstreicht. Schwangere möchten verständlicherweise keinerlei potenziell schädliche Stoffe an ihr Ungeborenes weitergeben – die Behörden raten hier zu allgemein vorbeugenden Maßnahmen (siehe Tipps unten), betonen aber, dass bislang keine akute Gefährdung bekannt ist.
Für Allergiker und Menschen mit empfindlichem Immunsystem ist vor allem interessant, ob Mikroplastik möglicherweise Abwehrreaktionen oder Allergien fördern könnte. Auch dazu läuft die Forschung. Manche Wissenschaftler vermuten, dass die winzigen Teilchen das Immunsystem ständig leicht reizen könnten – ähnlich wie Feinstaub – und so Entzündungen begünstigen. Mikroplastik trägt außerdem oft Chemikalien in sich (z.B. Weichmacher, Flammschutzmittel) oder kann Schadstoffe aus der Umwelt adsorbieren. Diese könnten theoretisch im Körper freigesetzt werden und z.B. hormonähnliche Wirkungen entfalten oder Allergien beeinflussen. All das ist aber wissenschaftlich noch nicht abschließend belegt. Wenn du unter Allergien leidest, gibt es derzeit keinen speziellen Warnhinweis der Ärzte in Bezug auf Mikroplastik – doch Schaden kann es sicher nicht, die persönliche Belastung so gering wie möglich zu halten.
Gibt es Grenzwerte oder offizielle Empfehlungen?
Regulierte Grenzwerte für Mikroplastik im Trinkwasser gibt es bislang nicht. Weder die deutsche Trinkwasserverordnung noch EU-Richtlinien enthalten aktuell konkrete Höchstwerte für Mikroplastikpartikel. Das liegt vor allem daran, dass bisher kein standardisiertes Messverfahren und keine ausreichenden Daten vorlagen, um einen sinnvollen Grenzwert abzuleiten. Stattdessen hat man sich zunächst auf die Entwicklung von Messmethoden und das Sammeln von Informationen konzentriert. Wie erwähnt, hat die EU 2024 eine einheitliche Methode zur Überwachung von Mikroplastik im Wasser verabschiedet. In den nächsten Jahren sollen alle Mitgliedstaaten ihre Trinkwässer untersuchen und regelmäßig Bericht erstatten. Diese Daten werden dann ausgewertet, um zu entscheiden, ob ein Grenzwert oder weitere Regulierung erforderlich sind.
Das bedeutet: Aktuell gilt in Deutschland der allgemeine Anspruch, dass Trinkwasser “frei von genussuntauglichen oder gesundheitsschädlichen Stoffen” sein muss. Solange Mikroplastik in den gemessenen Konzentrationen als ungefährlich eingeschätzt wird, besteht keine Pflicht für Wasserversorger, es speziell herauszufiltern – umso mehr, als eine vollständige Entfernung technisch sehr aufwendig wäre. Sollte die Wissenschaft künftig zu dem Schluss kommen, dass bestimmte Partikelgrößen oder Konzentrationen doch ein Risiko darstellen, werden Behörden entsprechend reagieren. Einige Experten fordern schon jetzt vorsorglich Richtwerte. So schlagen etwa manche vor, eine Belastung von maximal 10 Mikrogramm Plastik pro Liter als Orientierung zu nehmen, doch das ist kein offizieller Wert, sondern eine grobe Faustzahl. Fakt ist: Noch gibt es keinen anerkannten gesundheitlichen Richtwert. Daher lohnt es sich umso mehr, auf dem Laufenden zu bleiben – die Erkenntnisse entwickeln sich ständig weiter.
Leitungswasser vs. Mineralwasser: Was ist unbedenklicher?
Gerade für dich als gesundheitsbewusster Verbraucherin (und vielleicht als Elternteil) stellt sich die Frage, ob du lieber Leitungswasser oder Flaschenwasser trinken sollst – auch in Hinsicht auf Mikroplastik. Die aktuelle Datenlage und Expertenempfehlung ist hier ziemlich eindeutig: Leitungswasser ist in Deutschland in aller Regel die bessere Wahl, auch was Mikroplastik angeht.
Warum? Leitungswasser stammt überwiegend aus Grundwasser oder geschützten Talsperren, wird gründlich gefiltert und steht meist ohne lange Lagerung frisch zur Verfügung. Plastikrückstände haben dabei kaum eine Chance, ins Wasser zu gelangen – und wenn doch, dann in verschwindend kleiner Anzahl. Mineralwasser in Flaschen hingegen ist ein verpacktes Lebensmittel: Kommt Wasser mit Plastikverpackungen in Kontakt (Flasche, Deckel, Dichtungen), sind geringe Abrieb-Partikel praktisch unvermeidlich. Selbst bei Glasflaschen können z.B. die Deckeldichtungen aus Kunststoff Partikel abgeben. Außerdem lagern Mineralwässer oft längere Zeit und werden transportiert, was zusätzlichen Abrieb fördern kann. Tests haben ergeben, dass viele Marken-Mineralwässer winzige Plastikfragmente enthalten – in unbedenklich erscheinenden Mengen, aber doch mehr als im Leitungswasser.
Hinzu kommt, dass Flaschenwasser auch aus anderen Gründen nicht automatisch „reiner“ ist: In Mineralwasser finden sich z.B. immer wieder Spuren von Schadstoffen (etwa aus landwirtschaftlichen Einträgen) oder es schneidet in Tests wegen höherer Keimbelastung schlechter ab. Leitungswasser unterliegt strengeren Kontrollen – es wird in Deutschland täglich getestet und muss strenge Grenzwerte für zahlreiche Stoffe einhalten. Stiftung Warentest und Öko-Test kommen regelmäßig zum Schluss, dass gutes Leitungswasser mindestens ebenso hochwertig ist wie gekauftes Wasser. Mikroplastik macht da keine Ausnahme.
Natürlich kann es besondere Situationen geben – etwa veraltete Hausleitungen oder Kontaminationen – in denen Leitungswasser Nachteile hat. Aber bezogen auf Mikroplastik gilt: Trinkwasser aus dem Hahn ist in der Regel mikroplastikärmer als Wasser aus Plastikflaschen. Wenn du also Plastikpartikeln aus dem Weg gehen möchtest, fährst du mit Leitungswasser (wo es qualitativ einwandfrei ist) am besten. Und nebenbei tust du noch etwas Gutes für die Umwelt, weil du Plastikmüll durch Flaschen vermeidest.
Wie kannst du Mikroplastik im Trinkwasser reduzieren oder vermeiden?
Auch wenn die Belastung durch Mikroplastik im Trinkwasser sehr gering ist, möchtest du vielleicht vorsorglich so wenig Plastik wie möglich aufnehmen – gerade für deine Kinder und während der Schwangerschaft. Zum Glück kannst du mit ein paar einfachen Alltagsentscheidungen dazu beitragen, die Mikroplastik-Aufnahme weiter zu senken. Hier einige Tipps in direkter Ansprache:
- Greif zum Leitungswasser statt zur Plastikflasche: Das ist der simpelste und effektivste Rat. Leitungswasser enthält deutlich weniger Mikroplastik als abgefülltes Wasser. Füll es zu Hause in ein Glas oder eine Edelstahl-Trinkflasche ab. So vermeidest du Plastikabrieb komplett und sparst noch Geld und schlepperisches Mühsal.
- Wenn Mineralwasser, dann in Glasflaschen: Falls du nicht auf Mineral- oder Tafelwasser verzichten möchtest, wähle bevorzugt Glasflaschen oder Getränkekartons. Studien zeigen, dass Wasser aus Glas- oder Kartonverpackungen weniger Mikroplastik enthält als solches aus PET-Flaschen. Auch bei Sprudel-Siphons oder Gallonen für Wasserspender auf BPA-freies Material oder Glas achten.
- Benutze keine plastikhaltigen Wasserkocher oder -filter: Viele Teetrinker kochen ihr Wasser in Kunststoff-Wasserkochern – dabei können sich ebenfalls Partikel lösen. Besser sind Edelstahl- oder Glaswasserkocher. Gleiches gilt für Filterkannen: Wenn du filtern möchtest, nimm ein Modell ohne Kunststoffkontakt mit dem gefilterten Wasser (es gibt z.B. Edelstahl-Filtergehäuse). Insgesamt raten Experten aber: Eine zusätzliche Filterung des deutschen Leitungswassers ist nicht nötig – es ist bereits von hoher Qualität und weitere Filter können sogar Keime ansiedeln.
- Wasser abkochen und absetzen lassen: Eine aktuelle Studie aus China hat herausgefunden, dass Abkochen von Leitungswasser einen Großteil der Mikro- und Nanoplastikpartikel entfernen kann. In hartem Wasser (hoher Mineralgehalt) sanken über 80 % der Partikel (0,1–150 µm) zu Boden, in weichem Wasser ~25 %. Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, kannst du Wasser sprudelnd aufkochen und danach durch einen Kaffeefilter oder ein Tuch (am besten aus Stoff, nicht Mikroplastik!) gießen. Verwende dabei einen Topf oder Wasserkocher aus Metall und einen Filter ohne Plastikgehäuse, damit du nicht neue Partikel einträgst. Beachte: Ganz 100 % entfernt man Mikroplastik dadurch auch nicht, und es kostet Energie – notwendig ist es im deutschen Alltag laut Experten nicht, aber es kann dein Sicherheitsgefühl stärken.
- Für Babynahrung: Glasflaschen oder abgekühltes Wasser verwenden: Wenn du Babyfläschchen zubereitest, bedenke, dass herkömmliche Kunststoff-Babyflaschen aus Polypropylen beim Einfüllen von heißem Wasser sehr viele Mikroplastikteilchen freisetzen können. Eine Studie schätzt, dass Babys im ersten Lebensjahr täglich bis zu 1–2 Millionen Partikel aus der Flasche aufnehmen, wenn regelmäßig mit Kunststoffflaschen und heißem Wasser gearbeitet wird. Um das zu vermeiden, kannst du Glas-Babyflaschen benutzen. Alternativ lass abgekochtes Wasser für die Säuglingsnahrung etwas abkühlen (auf ca. 40–50 °C) bevor du es in die Plastikflasche füllst – so reduzierst du den Abrieb erheblich. Und rühre das Milchpulver sachte um, statt heftig zu schütteln.
Zum Schluss noch ein allgemeiner Rat: Plastikverbrauch reduzieren, wo immer möglich. Jede Plastikverpackung, die du einsparst, jeder synthetische Textilfussel weniger – all das trägt dazu bei, dass insgesamt weniger Mikroplastik in Umlauf kommt. Komplett vermeiden lässt es sich im modernen Alltag kaum, aber du kannst die Belastung im Haushalt minimieren, z.B. durch regelmäßiges Staubwischen (gegen Mikroplastik im Hausstaub), Verzicht auf Peelingprodukte mit Plastikkügelchen, Waschen synthetischer Kleidung in speziellen Waschbeuteln usw. Solche Maßnahmen schützen nicht nur dich, sondern kommen auch der Umwelt zugute.
Fazit
Für dich und deine Familie bedeutet all das: Trinkwasser in Deutschland kannst du weiterhin mit gutem Gefühl genießen. Die bislang gefundenen Mikroplastik-Mengen sind so gering, dass Experten kein akutes Gesundheitsrisiko sehen. Dennoch nehmen wir alle täglich Mikroplastik aus unterschiedlichsten Quellen auf – ein moderner Umstand, dem sich die Wissenschaft aufmerksam widmet. Bleibe informiert, handle umsichtig (aber ohne Panik) und triff im Alltag ein paar plastikbewusste Entscheidungen. So kannst du das Restrisiko weiter minimieren, bis die Forschung alle offenen Fragen geklärt hat. Dein Körper braucht ausreichend Wasser – und der Nutzen des Trinkwassers überwiegt bei weitem die bislang spekulativen Risiken durch Mikroplastik. In diesem Sinne: Prost – auf dein Wohlbefinden und eine Zukunft mit weniger Plastik!