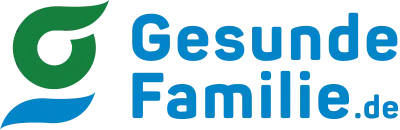Mikroplastik: Wie es unsere Gesundheit beeinflussen kann
Mikroplastik ist allgegenwärtig in unserer Umwelt – in der Luft, im Wasser, in Lebensmitteln und unzähligen Alltagsprodukten. Vielleicht hast du schon von dieser unsichtbaren Gefahr gehört und fragst dich, ob und wie sie deiner Gesundheit und der Gesundheit deiner Familie schaden kann. Insbesondere werdende Eltern, junge Familien und Allergiker machen sich Sorgen: Gelangen die winzigen Plastikteilchen in unseren Körper, und was richten sie dort an? In diesem Artikel erfährst du sachlich und einfühlsam, was Mikroplastik genau ist, wo es dir im Alltag begegnet, wie es in deinen Körper gelangt und welche gesundheitlichen Risiken von Mikroplastik bekannt oder zu befürchten sind – besonders mit Blick auf Kinder, Schwangere und Menschen mit Allergien.
 Abbildung: Plastikmüll in der Umwelt – in der Natur zerfällt er zu Mikroplastik. Solche unsichtbaren Partikel belasten Böden, Gewässer und letztlich auch unsere Körper.
Abbildung: Plastikmüll in der Umwelt – in der Natur zerfällt er zu Mikroplastik. Solche unsichtbaren Partikel belasten Böden, Gewässer und letztlich auch unsere Körper.
Was ist Mikroplastik?
Unter Mikroplastik versteht man winzige Kunststoffteilchen, die kleiner als 5 Millimeter sind – oft sind sie mikroskopisch klein und mit bloßem Auge kaum sichtbar. Diese Partikel entstehen entweder unbeabsichtigt als sekundäres Mikroplastik beim Zerfall größerer Plastikteile (durch UV-Licht, Abrieb, Verwitterung usw.), oder sie werden gezielt hergestellt als primäres Mikroplastik. Primäre Mikroplastikpartikel werden z.B. in der Industrie Produkten beigemischt, etwa als Mikrokügelchen in Kosmetik und Peeling-Produkten. Sekundäres Mikroplastik dagegen entsteht überall dort, wo größerer Plastikmüll in immer kleinere Fragmente zerbricht – zum Beispiel wenn Plastiktüten, Verpackungen oder Spielzeuge in der Umwelt liegen und mit der Zeit zerfallen.
Plastik ist ein extrem langlebiges Material. Was einmal als Müll in die Natur gelangt, bleibt oft jahrzehntelang erhalten und zerfällt lediglich in immer kleinere Stücke. So reichert sich Mikroplastik in der gesamten Umwelt an: Man findet es in den Meeren und Sedimenten, in Flüssen und Böden und sogar in entlegenen Regionen wie der Arktis. Weltweit wurden winzige Kunststoff-Partikel bereits auf dem Meeresgrund und auf den Gipfeln hoher Berge nachgewiesen. Die enorme Verbreitung führt dazu, dass jedes Ökosystem – und damit auch wir Menschen – inzwischen ungewollt mit Mikroplastik in Berührung kommen.
Wo begegnet es uns im Alltag?
Mikroplastik begegnet dir täglich, oft ohne dass du es merkst. Die Quellen sind vielfältig: Es kann aus Produkten stammen, die wir nutzen, oder aus der Umwelt, die uns umgibt. Hier die wichtigsten Alltagsbereiche, in denen Mikroplastik vorkommt:
-
In der Luft: Tatsächlich schweben winzige Plastikpartikel auch in der Atemluft. Mikroplastik wird durch Industrie und Verkehr in die Atmosphäre getragen – zum Beispiel durch den Abrieb von Autoreifen oder den Abrieb von Straßenmarkierungen und Kunststoffoberflächen. Auch in Innenräumen gibt es Mikroplastik, etwa aus Textilfasern (z.B. Fusseln von synthetischer Kleidung oder Teppichen) und Hausstaub. Studien haben Mikroplastik sogar weit entfernt von Städten in der Luft nachgewiesen, etwa auf Berggipfeln und in Polarregionen. Das bedeutet: Mit jedem Atemzug können wir kleinste Plastikteilchen einatmen. Innenräume weisen oft höhere Konzentrationen auf als draußen, da sich dort Fasern aus Teppichen, Möbeln und Kleidung ansammeln.
-
Im Wasser: Unser Trinkwasser kann mit Mikroplastik belastet sein. Besonders Mineralwasser aus Plastikflaschen enthält oft viele Partikel – eine Untersuchung fand in Flaschenwasser pro Liter teils hunderttausende Mikropartikel. Aber auch Leitungswasser kann Spuren enthalten, je nach Wasserquelle und Rohrleitungen. Mikroplastik gelangt über Flüsse in Seen und ins Grundwasser. Sogar Regen transportiert Mikropartikel aus der Luft auf den Boden. Beim Baden im Meer oder See nimmst du unweigerlich etwas Mikroplastik auf, denn unsere Gewässer sind durch den Zustrom an Plastikmüll mittlerweile stark belastet. Kläranlagen können die winzigen Teilchen nicht vollständig aus dem Abwasser filtern, sodass jährlich Millionen bis Milliarden Mikrofasern und Partikel in Flüsse und Meere gespült werden.
-
In Lebensmitteln: Zahlreiche Studien weisen Mikroplastik in verschiedenen Lebensmitteln nach. Besonders betroffen sind Fisch und Meeresfrüchte, da Meeresorganismen die Partikel aus verschmutztem Wasser aufnehmen. Wenn wir z.B. Muscheln oder Garnelen essen, können wir dabei die in ihren Mägen befindlichen Mikroplastikteilchen mitverzehren. Auch Speisesalz – insbesondere Meersalz – enthält oft messbare Mengen an Mikroplastik, da Meerwasser bei der Salzgewinnung verdunstet und die zurückbleibenden Kristalle die Partikel einschließen. Sogar Honig und Bier wurden schon mit Mikroplastikpartikeln gefunden (über Bienenstock-Staub bzw. Brauwasser). Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass auch Obst und Gemüse Mikroplastik aus dem Boden aufnehmen können – beispielsweise wurden in einigen Proben von Äpfeln, Karotten oder Salat mikroskopisch kleine Kunststoffpartikel entdeckt. Die genauen Aufnahmemengen aus der Nahrung sind noch unklar, doch über die Ernährung nehmen wir ständig geringe Mengen Mikroplastik auf.
-
In Alltagsprodukten: Mikroplastik steckt in oder entsteht aus vielen Produkten, die wir täglich benutzen. Ein bekanntes Beispiel sind Kosmetik- und Pflegeprodukte: In manchen Peelings, Duschgels, Zahnpasten oder Schminkartikeln waren oder sind winzige Plastikpartikel als Schleif- oder Bindemittel enthalten. Zwar wurden Mikroplastik-Kügelchen in Kosmetika in der EU bereits großteils verboten oder reduziert, doch es gibt immer noch Produkte mit Kunststoffbestandteilen (z.B. in Form von flüssigen Polymeren, die nicht als feste Körnchen sichtbar sind). Auch Kleidung aus Synthetikfasern (Polyester, Fleece, Nylon etc.) setzt bei jeder Wäsche Abermillionen Mikrofaser-Bruchstücke frei. Diese gelangen über das Abwasser in die Umwelt, da Waschmaschinenfilter und Klärwerke sie nicht vollständig zurückhalten können. Reifenabrieb auf den Straßen ist eine weitere riesige Mikroplastikquelle – jedes Mal, wenn du Auto fährst oder ein Bus vorbeifährt, entstehen durch die Reibung Gummipartikel, die nichts anderes als Mikroplastik sind. Selbst beim Essen aus Plastikgeschirr oder Trinken aus Einwegbechern können sich kleinste Teilchen lösen, besonders wenn die Behälter erhitzt oder zerkratzt werden. All diese alltäglichen Quellen summieren sich zu einer ständigen, unmerklichen Mikroplastik-Exposition.
Zusammengefasst: Mikroplastik ist überall um uns herum. Ob in der staubigen Wohnzimmerluft, im Sprudelwasser, im Meersalz oder in der Kosmetik – wir können ihm kaum entgehen. Doch wie dringen diese Partikel tatsächlich in unseren Körper ein? Das schauen wir uns als Nächstes an.
Wie gelangt Mikroplastik in den Körper?
Damit Mikroplastik unserer Gesundheit schaden kann, muss es erst einmal in unseren Körper gelangen. Die gute Nachricht: Nicht jeder Kontakt mit einem belasteten Gegenstand führt automatisch zu einer Aufnahme. Die Partikel müssen bestimmte Wege nehmen, um von der Umwelt ins Innere unseres Körpers zu kommen. Hier sind die wichtigsten Aufnahmewege für Mikroplastik:
1. Über die Atmung (Einatmen): Einen Teil des täglich eingeatmeten Staubs machen mikroskopisch kleine Plastikpartikel aus. Diese Partikel aus der Luft können tief in unsere Atemwege und Lungen vordringen. Vor allem sehr kleine Teilchen (< 10 Mikrometer) werden bis in die Bronchien und möglicherweise in die Lungenbläschen getragen. Dort können sie sich ablagern oder von Immunzellen aufgenommen werden. Studien haben erstmals Mikroplastik in menschlichem Lungengewebe gefunden – sogar in den tieferen Regionen der Lunge. Das Einatmen von Plastikstaub ist besonders in Innenräumen relevant, wo sich Fasern aus Kleidung und Teppichen ansammeln. Aber auch draußen, nahe befahrenen Straßen oder Industriegebieten, ist die Luft mit Abrieb-Partikeln belastet. Feine Partikel können stunden- bis tagelang in der Luft schweben und über weite Strecken transportiert werden. Wenn wir sie einatmen, bleiben viele in den Atemwegen hängen (Nase, Rachen, Bronchien). Größere Partikel werden meist mit dem Schleim wieder nach außen befördert (und dann verschluckt oder ausgehustet). Kleinere Partikel jedoch können sich im Lungengewebe festsetzen. Das Immunsystem versucht, sie dort zu bekämpfen – was zu lokalen Entzündungen führen kann. Wissenschaftler befürchten, dass dauerhafte Belastung mit solchen Partikeln das Risiko für Atemwegsprobleme erhöht (dazu mehr im Abschnitt über gesundheitliche Auswirkungen).
2. Über den Mund (Essen und Trinken): Der häufigste Weg, wie Mikroplastik in den Körper gelangt, ist oral, also durch Verschlucken. Wir nehmen täglich winzige Plastikteilchen mit unserer Nahrung und Getränken auf. Wie kommt das? Zum einen sind wie erwähnt viele Lebensmittel selbst mit Mikroplastik kontaminiert (z.B. Meeresfrüchte, Salz, Getränke). Zum anderen verschlucken wir auch Partikel, die ursprünglich aus der Luft stammen: Wenn sich Staub auf unsere Nahrung setzt oder wir Mikroplastik aus der Nase verschlucken (Nasenschleim wird natürlicherweise in den Rachen transportiert und geschluckt), gelangt es in den Verdauungstrakt. Besonders Kleinkinder nehmen viel über den Mund auf – sie stecken alles Mögliche in den Mund und schlucken auch mehr Staub ab, weil sie oft Hände und Gegenstände ablecken. Über Trinkwasser oder andere Getränke kommt ebenfalls Mikroplastik hinein. Ein Beispiel: Wenn dein Kind aus einer Plastik-Babyflasche trinkt, können sich durch die Hitze des abgekochten Wassers winzige Plastikpartikel aus der Flasche lösen. Untersuchungen ergaben, dass Babys, die aus Polypropylen-Fläschchen gefüttert werden, täglich Millionen von Mikroplastik-Partikeln aufnehmen können. Auch Getränke in Einweg-Plastikflaschen oder heiße Flüssigkeiten in to-go-Bechern lösen kleine Mengen Kunststoff. All diese Partikel schlucken wir herunter. Im Magen-Darm-Trakt angekommen, passiert ein Teil der Teilchen einfach durch und wird wieder ausgeschieden (Mikroplastik wurde bereits im Stuhl von Menschen rund um den Globus nachgewiesen). Einige kleinere Partikel (vor allem im Nanometer-Bereich) können aber die Darmschleimhaut passieren und ins Blut übergehen. Über die Darm-Lymphbahnen oder direkt über die Darmwand gelangen solche winzigen Partikel in die Blutbahn und werden so im Körper verteilt. Tatsächlich wurde 2022 erstmals Mikroplastik im menschlichen Blut wissenschaftlich nachgewiesen – ein Hinweis darauf, dass ein Teil der geschluckten Partikel unsere Barrieren überwinden kann.
3. Über die Placenta und Muttermilch (während Schwangerschaft und Stillzeit): Besonders alarmierend ist die Entdeckung, dass Mikroplastik sogar die Schutzbarrieren zwischen Mutter und Kind überwinden kann. In einer Studie aus dem Jahr 2020 wurden erstmals Mikroplastikpartikel in menschlichen Plazentas gefunden. Forscher untersuchten die Plazenten mehrerer Mütter direkt nach der Geburt und entdeckten darin winzige Kunststoffteilchen. Wie genau sie dorthin gelangt sind, ist noch unklar – vermutlich über den Blutkreislauf der Mutter, die Mikroplastik eingeatmet oder gegessen hat, welches dann bis in den Mutterkuchen vorgedrungen ist. Da die Plazenta den Fötus versorgt, ist es möglich, dass Partikel auch in den Körper des ungeborenen Kindes gelangen. Zudem wurde jüngst Mikroplastik in Muttermilch nachgewiesen. In einer italienischen Studie enthielten die Muttermilch-Proben von 26 von 34 stillenden Frauen Plastikpartikel verschiedenster Sorten. Das zeigt, dass ein Baby beim Stillen Mikroplastik aufnehmen kann. Bislang ist nicht bekannt, welche Auswirkungen das auf Säuglinge hat – aber die Vorstellung ist für Eltern natürlich besorgniserregend. Wichtig zu betonen: Stillen bleibt dennoch das Beste für das Baby, da die Vorteile der Muttermilch jeden möglichen Schaden durch Mikroplastik bei weitem überwiegen. Die Forscherin der Studie rät daher, dass solche Erkenntnisse nicht vom Stillen abhalten, sondern zum Umdenken in Politik und Umwelt führen sollten. Für uns bedeutet es: Selbst vor dem ungeborenen Kind und dem Säugling macht Mikroplastik leider nicht Halt.
4. Über die Haut: Könnten Mikropartikel auch einfach durch die Haut in unseren Körper gelangen? Die Haut ist eigentlich eine sehr effektive Barriere. Nach heutigem Wissen ist es unwahrscheinlich, dass Mikroplastik in nennenswertem Umfang durch gesunde, intakte Haut dringt. Die meisten Partikel sind dafür schlicht zu groß. Selbst Nanoplastik (also Teilchen im extrem kleinen Nanometer-Maßstab) kann die äußeren Hautschichten nur schwer überwinden. Allerdings gibt es noch kaum Forschung dazu, ob beschädigte Haut (z.B. Wunden) oder die zarte Babyhaut durchlässiger sein könnten. Babys und Kleinkinder haben eine noch reifende Hautbarriere – erst ab etwa dem vierten Lebensjahr ist die Haut so dicht wie bei Erwachsenen. In den ersten Lebensjahren könnte daher theoretisch ein höheres Risiko bestehen, dass winzige Partikel durch die Haut gelangen, vor allem durch Mikroverletzungen oder wenn die Partikel in Cremes/Lotionen direkt aufgetragen werden. Bisher fehlen hierzu belastbare Daten. Insgesamt gilt: Der Hauptaufnahmeweg von Mikroplastik ist nicht die Haut, sondern Atemwege und Verdauung.
Du siehst, Mikroplastik findet verschiedene Wege in unseren Organismus. Einatmen, Verschlucken und selbst die Mutter-Kind-Übertragung sind die relevantesten Routen. Sobald die Partikel erstmal im Körper sind, stellt sich die dringende Frage: Was passiert dann? Bleiben sie irgendwo stecken? Werden sie wieder ausgeschieden? Und vor allem – können sie unserer Gesundheit messbar schaden? Im nächsten Abschnitt betrachten wir die bekannten und vermuteten Auswirkungen von Mikroplastik im Körper.
Welche gesundheitlichen Auswirkungen sind bekannt oder werden vermutet?
Wissenschaftler stehen noch am Anfang, die Gesundheitsrisiken von Mikroplastik umfassend zu verstehen. Fest steht: Komplett harmlos sind diese Fremdpartikel wahrscheinlich nicht. Bei Tieren und im Labor wurden bereits etliche bedenkliche Effekte beobachtet. Beim Menschen hingegen liegen erst wenige Daten vor – doch erste Hinweise deuten auf mögliche Schäden hin. Hier fassen wir zusammen, welche Auswirkungen bekannt sind oder befürchtet werden, wenn Mikroplastik in den Körper gelangt:
-
Reizungen und Entzündungen: Wenn fremde Partikel ins Gewebe geraten, reagiert der Körper oft mit Abwehr. Mikroplastik kann Entzündungsreaktionen auslösen – das zeigen sowohl Zellversuche als auch Tierstudien. In der Lunge beispielsweise rufen eingeatmete Partikel eine Abwehr durch Fresszellen hervor, die Entzündungsstoffe freisetzen. Chronische Entzündungen könnten die Folge sein, wenn ständig Plastikpartikel in der Lunge verbleiben. Ähnliches gilt für den Darm: In Tierstudien führte Mikroplastik im Futter zu Entzündungszeichen im Darmgewebe und zu einer gestörten Darmflora. Erste Untersuchungen beim Menschen ergaben, dass Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa) tendenziell mehr Mikroplastik in ihrem Stuhl hatten als gesunde Vergleichspersonen. Das legt nahe, dass eine hohe Mikroplastik-Belastung im Verdauungstrakt mit Darmentzündungen in Zusammenhang stehen könnte – ob als Ursache oder Folge, ist noch unklar. Auch in der Leber und Niere von Labortieren fanden Forscher Mikroplastik und Anzeichen von Gewebereizungen. Diese Entzündungsprozesse sind alarmierend, weil sie langfristig gesundes Gewebe schädigen und möglicherweise andere Krankheiten begünstigen können.
-
Atemwegs- und Lungenprobleme: Wie erwähnt, kann eingeatmetes Mikroplastik bis in die Lungen vordringen. Dort könnte es ähnlich wirken wie Feinstaub aus anderen Quellen (z.B. Ruß): Reizung der Atemwege, Husten, Bronchitis und im schlimmsten Fall Entwicklung von Asthma oder chronischen Lungenerkrankungen. Erste Studien an exponierten Menschen zeigen tatsächlich, dass das Einatmen von Plastikstaub Lungenentzündungen und andere Atemwegsprobleme fördern kann. Besonders Beschäftigte in Industriezweigen, die viel Kunststoffstaub erzeugen (z.B. Kunststoffverarbeitung), könnten gefährdet sein – hier beobachtet man vermehrt atemwegsbezogene Beschwerden. Auch für die allgemeine Bevölkerung ist denkbar, dass die steigende Mikroplastik-Belastung der Luft zur Zunahme von Allergien und Asthma beiträgt (siehe auch Abschnitt Allergien weiter unten). Zudem könnte dauerhafte Inhalation von Mikroplastik das Herz-Kreislauf-System belasten: Feine Partikel in der Lunge stehen im Verdacht, Entzündungen im ganzen Körper anzukurbeln und sogar die Blutgefäße zu schädigen, was auf Dauer Herzkrankheiten begünstigen kann. Diese Zusammenhänge kennt man von städtischem Feinstaub – ob Plastikpartikel ähnlich wirken, wird derzeit intensiv erforscht.
-
Allergien und Immunsystem: Mikroplastik könnte Allergien verschlimmern oder sogar mitverursachen. Das Immunsystem erkennt die Kunststoffpartikel als Fremdkörper und kann überreagieren. Forscher vermuten, dass Mikroplastik eine sensibilisierende Wirkung hat – sprich, es regt das Immunsystem an und hält es in Alarmbereitschaft. Bei ohnehin allergieanfälligen Personen könnte dies dazu führen, dass allergische Reaktionen häufiger oder stärker auftreten. Mikroplastikpartikel könnten beispielsweise Pollen oder Schadstoffe tragen, die dann tiefer in die Lunge gelangen und dort heftigere Asthmaanfälle auslösen. Auch könnten die Teilchen selbst als eine Art Adjuvans (Verstärker) wirken: Sie fördern die Ausschüttung von entzündungsfördernden Botenstoffen, was Allergiesymptome anfeuert. Es gibt Hinweise darauf, dass Gebiete mit höherer Mikroplastik-Belastung in der Luft auch höhere Raten an Heuschnupfen und Asthma zeigen – ein endgültiger Beweis steht aber noch aus. Neben Allergien könnte das Immunsystem auch anderweitig beeinträchtigt werden: Chronische Mikropartikel-Belastung kann die Immunabwehr schwächen, weil ständig Immunzellen mit diesen Fremdkörpern beschäftigt sind. Laboruntersuchungen zeigen z.B., dass Makrophagen (Fresszellen) durch aufgenommene Plastikteilchen „überfordert“ werden und vorzeitig absterben können, was die lokale Abwehr schwächt. Insgesamt warnen Expert*innen, dass Mikroplastik eine dauerhaft erhöhte Entzündungsbereitschaft im Körper fördern könnte – was das Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringt und sowohl Allergien als auch Autoimmunerkrankungen begünstigen könnte.
-
Hormonelle Störungen und Fortpflanzung: Plastik ist nicht nur ein physikalisches Partikel, sondern oft auch ein Chemikalien-Cocktail. In Kunststoffen stecken Weichmacher, Bisphenole, Flammschutzmittel und andere Zusatzstoffe, von denen viele hormonell wirksam oder giftig sind. Mikroplastik kann diese Stoffe im Körper freisetzen oder auch Schadstoffe aus der Umwelt an seiner Oberfläche anreichern. Somit fungieren die Partikel unter Umständen als Träger für Schadstoffe, die dann in unseren Organen ankommen. Einige dieser Chemikalien (z.B. Phthalat-Weichmacher und Bisphenol A) sind bekannt dafür, den Hormonhaushalt zu stören. Sie können etwa wie Umwelthormone (endokrine Disruptoren) wirken und natürliche Hormonsignale blockieren oder nachahmen. Bei Ungeborenen und Kindern kann dies zu Entwicklungsstörungen führen; bei Erwachsenen z.B. zu Fruchtbarkeitsproblemen. In der Tat stehen Plastikbestandteile seit Längerem im Verdacht, die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Nun mehren sich Hinweise, dass auch Mikroplastik-Partikel selbst die Fortpflanzungsorgane erreichen: Forscher fanden Mikroplastik in menschlichem Hoden- und Eierstockgewebe, und eine chinesische Studie entdeckte Kunststoffpartikel sogar in menschlichem Sperma. Bei Tieren wurde beobachtet, dass sich mit steigender Mikroplastikbelastung der Spermienzahl verringert. Solche Funde sind noch neu, doch sie befeuern die Sorge, dass Mikroplastik zu Unfruchtbarkeit beitragen könnte. Auch Schwangerschaftskomplikationen sind nicht ausgeschlossen – Entzündungen oder hormonelle Störungen durch Mikroplastik könnten theoretisch Frühgeburten oder Entwicklungsstörungen beim Fötus begünstigen (konkrete Belege fehlen hier noch, es wird aber erforscht).
-
Krebsrisiken: Könnten die Plastikpartikel langfristig sogar Krebs auslösen? Einige Wissenschaftler halten das für möglich, wenn auch noch nicht bewiesen. Krebserregende Stoffe sind auf jeden Fall in manchen Kunststoffen enthalten (etwa bestimmte Weichmacher oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die sich an Plastik anlagern können). Falls Mikroplastik solche Substanzen in Körpergewebe transportiert, könnte dies lokal zu Zellschäden führen. Zudem führen chronische Entzündungen – wie sie durch anhaltende Fremdpartikel entstehen könnten – auf Dauer zu einer erhöhten Zellteilung und können somit das Krebsrisiko steigern. Erste epidemiologische Hinweise gibt es z.B. im Bereich Darmgesundheit: Eine Hypothese ist, dass die steigende Mikroplastikaufnahme mit der Nahrung einer der Faktoren sein könnte, warum Darmkrebs bei jüngeren Erwachsenen häufiger wird. In der oben erwähnten Studie zu Darmpatienten wurde spekuliert, dass Mikroplastik an der Zunahme bestimmter Darmerkrankungen und vielleicht auch Darmtumoren beteiligt sein könnte. Auch Lungenkrebs könnte durch das Einatmen von Kunststofffasern gefördert werden – ähnlich wie es bei Asbestfasern der Fall war, wobei Mikroplastik zum Glück nicht die gleiche Fasergestalt hat. Klar ist: Einige Plastikadditive sind mutagen (erbgutverändernd) oder karzinogen – z.B. krebserregende Weichmacher, die sich in Körpergewebe anreichern können. Mikroplastik an sich ist kein chemischer Stoff, aber es trägt diese Chemikalien oft in sich. Es ist daher zumindest plausibel, dass eine ständige Mikropartikel-Präsenz in Organen das Entstehen von Krebs begünstigt. Beweise bei Menschen stehen allerdings noch aus; dies bleibt ein Verdachtsmoment, das weiter erforscht wird.
Wie du siehst, sind die potenziellen Gesundheitsgefahren von Mikroplastik breit gefächert – von Atemwegsreizungen über Entzündungen, Allergien und Hormonstörungen bis hin zu möglicherweise erhöhtem Krebsrisiko. Wichtig ist zu verstehen: Viele dieser Effekte sind bislang Verdachtsmomente oder durch Tierstudien belegte Risiken, aber (noch) nicht endgültig beim Menschen nachgewiesen. Die Forschung steht hier wirklich erst am Anfang. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns daher an, was Wissenschaftler bisher wissen und welche Wissenslücken es gibt.
Warum besonders Kinder, Schwangere und Allergiker betroffen sind
Manche Bevölkerungsgruppen stehen im Zusammenhang mit Mikroplastik unter besonderer Beobachtung – allen voran Kinder, Schwangere (bzw. Föten) und Allergiker. Doch warum gerade sie? Die Antwort liegt in ihrer höheren Empfindlichkeit und Exposition:
Kinder: Babys und Kinder sind keine “kleinen Erwachsenen” – sie reagieren auf Umweltbelastungen oft sehr viel empfindlicher. Ihr Körper befindet sich im Wachstum und wichtige Organe sowie das Immunsystem entwickeln sich noch. In diesen sensiblen Entwicklungsphasen können Störeinflüsse von außen größere Schäden anrichten als später im Erwachsenenalter. Zudem nehmen Kinder verhältnismäßig mehr Schadstoffe auf als Erwachsene, bezogen auf ihr Körpergewicht. Beispielsweise atmet ein Kleinkind mehr Luft pro Kilogramm Körpergewicht und trinkt/isst mehr im Verhältnis zu seinem Gewicht – dadurch gelangt auch mehr Mikroplastik in Relation in ihren Organismus. Hinzu kommt das typische Verhalten von Kleinkindern: Sie krabbeln am Boden (wo sich Hausstaub und damit Mikroplastik sammelt) und stecken vieles in den Mund. Ein Baby schluckt beim Spielen auf dem Teppich deutlich mehr Staub und Partikel ab als ein Erwachsener, der auf dem Stuhl sitzt. Die Haut von Babys und Kleinkindern ist dünner und durchlässiger, sodass Schadstoffe leichter eindringen könnten (auch wenn Mikroplastik über die Haut eher selten ist, könnte dies bei Pflegeprodukten mit Partikeln relevant sein). All diese Faktoren führen dazu, dass Kinder einer höheren effektiven Mikroplastik-Dosis ausgesetzt sind. Gleichzeitig sind ihre Entgiftungssysteme (Leber, Nieren) noch nicht voll ausgereift, und die Blut-Hirn-Schranke ist in frühen Jahren durchlässiger – was bedeutet, dass Fremdstoffe eher ins Gehirn gelangen könnten. Zwar wissen wir noch nicht, was Mikroplastik langfristig in einem wachsenden Körper anrichtet, aber gerade das Unbekannte macht besorgt. Befunde wie Mikroplastik in Plazenta und Muttermilch lassen aufhorchen: Schon ab den ersten Lebenstagen ist ein Kind heute offenbar diesen Partikeln ausgesetzt. Experten vermuten, dass Mikroplastik in den frühen Lebensphasen z.B. Einfluss auf das Immunsystem nehmen könnte (Stichwort Allergierisiko) oder auf die neurologische Entwicklung – hier laufen wichtige Prozesse, die durch Entzündungen oder chemische Störeinflüsse beeinträchtigt werden könnten. Letztlich bedeutet “besonders betroffen” auch: Kinder haben die längste Lebenszeit vor sich, um mögliche langfristige Schäden anzusammeln. Was in der Kindheit in den Körper gelangt, bleibt eventuell Jahrzehnte dort und könnte erst in der Zukunft negative Folgen zeigen. Daher sind Kinder die vielleicht wichtigste Risikogruppe, wenn es um Mikroplastik geht.
Schwangere und Ungeborene: Während der Schwangerschaft tragen Mütter und Föten ein doppeltes Risiko. Die Mutter selbst ist durch die körperlichen Veränderungen oft sensibler – ihr Immunsystem arbeitet anders (damit der Körper das Baby nicht abstößt), sie atmet mehr Luft (erhöhter Sauerstoffbedarf) und isst ggf. mehr. Wenn sie Mikroplastik ausgesetzt ist, kann das ungeborene Kind mitbetroffen sein, wie Funde von Partikeln in der Plazenta zeigen. Die Plazenta versorgt den Fötus mit Nährstoffen und schützt ihn vor vielen Schadstoffen – jedoch offenbar nicht vollständig vor Mikroplastik. Welche Auswirkungen hat es, wenn ein Fötus mit Mikroplastik-Partikeln konfrontiert wird? Hier bewegen wir uns im Bereich von Vermutungen, da es dazu noch keine direkten Studien gibt. Allerdings wissen wir aus der Schadstoffforschung, dass bereits geringe Störungen in der embryonalen Entwicklung zu bleibenden Schäden führen können. Beispielsweise könnten Plastik-Chemikalien wie Weichmacher im Mikroplastik das empfindliche Hormonsystem des Fötus beeinflussen und etwa die Entwicklung der Geschlechtsorgane beeinträchtigen (tierische Studien legen das nahe). Mikroplastik-Partikel selbst könnten Entzündungen an der Plazenta hervorrufen, was theoretisch die Versorgung des Babys verschlechtert. Es gibt erste Hinweise darauf, dass hohe Kunststoffbelastungen mit niedrigeren Geburtsgewichten einhergehen könnten, aber hier ist noch viel Forschung nötig. Für Schwangere gilt jedenfalls: Sie tragen nicht nur die Verantwortung für ihren eigenen Körper, sondern auch für ein sich entwickelndes Leben, das extrem anfällig für Schadstoffe ist. Deshalb werden Schwangere als besonders schützenswerte Gruppe angesehen. Noch ein Aspekt: Stillende Mütter – sie geben eventuelle Belastungen weiter über die Muttermilch. Dass Mikroplastik in der Muttermilch gefunden wurde, ist daher ein Signal, dass auch in der Stillzeit eine Exposition weitergereicht wird. Insgesamt sind Schwangere und Neugeborene deshalb im Fokus, weil hier mögliche Schäden besonders folgenreich wären und es kaum Ausweichmöglichkeiten gibt (niemand kann komplett aufhören zu atmen oder zu essen, um Mikroplastik zu vermeiden).
Allergiker: Menschen, die an Allergien oder allergischem Asthma leiden, reagieren überempfindlich auf eigentlich harmlose Umweltstoffe (wie Pollen, Hausstaubmilben, bestimmte Nahrungsmittel). Ihr Immunsystem ist gewissermaßen in Alarmstimmung. Mikroplastik kann für Allergiker problematisch sein, da es einerseits selbst reizend wirkt und andererseits andere Allergene tiefer in den Körper bringen könnte. Wie bereits beschrieben, fördern Mikroplastikpartikel Entzündungen und könnten das Immunsystem dauerhaft stimulieren. Bei Allergikern, deren Immunsystem ohnehin überschießt, könnte diese zusätzliche Stimulation die Allergiebereitschaft erhöhen. Praktisch könnte das heißen: Jemand mit Hausstauballergie reagiert noch stärker, wenn der Hausstaub mit Plastikfasern durchsetzt ist. Oder ein Pollenallergiker bekommt heftigere Asthmasymptome, wenn auch Mikroplastik in der Luft ist, weil die Kombination aus Blütenpollen + Mikroplastik die Lunge doppelt reizt. Es wird auch diskutiert, ob Mikroplastik neue Allergien auslösen kann. Denkbar wäre, dass das Immunsystem auf die Plastikpartikel selbst allergisch reagiert (ähnlich wie auf Staub an sich) – bisher gibt es dafür aber keine gesicherten Belege. Eher wahrscheinlich ist die indirekte Wirkung: Mikroplastik könnte Schadstoffe und Allergene transportieren, z.B. Schimmelsporen oder chemische Rückstände, die dann im Körper Allergiereaktionen auslösen. Außerdem führt die Gegenwart von Mikroplastik zu oxidativem Stress in Zellen (weil Immunzellen Radikale produzieren, um die Partikel zu bekämpfen). Dieser Stress kann bestehende entzündliche Erkrankungen wie Neurodermitis oder Asthma weiter anfeuern. Zusammengefasst: Allergiker müssen zwar nicht in Panik verfallen, aber sie gehören zu denjenigen, die von einer höheren Mikroplastik-Belastung potentiell stärker beeinträchtigt werden könnten – einfach weil ihr Körper schon hypersensibilisiert ist. In Gebieten mit hoher Luftverschmutzung (inkl. Mikroplastik) sieht man tatsächlich in den letzten Jahrzehnten mehr Allergieerkrankungen, was die Vermutung stützt, dass diese Partikel eine Rolle spielen könnten.
Was die Forschung sagt
Angesichts all dieser möglichen Risiken stellt sich die Frage: Was sagt eigentlich die Wissenschaft? Wie sicher oder unsicher ist man sich über Mikroplastik und Gesundheit? Hier ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung:
Die Datenlage ist noch lückenhaft. Mikroplastik in der Umwelt ist zwar seit Jahren bekannt, doch die Erforschung der Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit steckt noch in den Kinderschuhen. Expert*innen betonen immer wieder, dass es große Wissenslücken gibt. So wissen wir zum Beispiel noch kaum, wie viel Mikroplastik ein Mensch täglich aufnimmt – Schätzungen variieren je nach Studie stark. Auch ist unklar, welcher Anteil davon im Körper verbleibt und welcher wieder ausgeschieden wird. Viele Studien, die Gefahren aufzeigen, stammen aus dem Labor (Zellkulturen) oder aus Tierversuchen. Die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf den Menschen ist nicht immer gegeben. Es ist also wichtig, die Risiken weder zu über- noch zu unterschätzen: Noch gibt es keinen endgültigen Beweis, dass Mikroplastik uns krank macht – aber es gibt genug alarmierende Hinweise, um genauer hinzuschauen.
Nachgewiesene Fakten: Was zweifelsfrei belegt ist: Mikroplastik dringt in den menschlichen Körper vor. Es wurde in Lungengewebe, Blut, Plazenta und Muttermilch nachgewiesen. Sogar in menschlichen Organen (Leber, Niere) von Verstorbenen hat man Mikroplastik-Partikel gefunden. Das heißt, die Exposition ist real und kein bloßer hypothetischer Wert. Außerdem ist gut dokumentiert, dass Mikroplastik bei Tieren vielfältige Schäden anrichten kann – Fische etwa zeigen Veränderungen im Verhalten und Stoffwechsel, wenn sie in plastikverseuchtem Wasser leben, und Mäuse entwickelten in Experimenten Entzündungen und Gewebeschäden, nachdem man ihnen Mikroplastik zu fressen gab. Diese Befunde beunruhigen die Wissenschaftsgemeinde, denn oft sind solche Tiermodelle ein Warnsignal für mögliche humanmedizinische Auswirkungen.
Vermutungen und aktuelle Studien: Zahlreiche Studien laufen derzeit, um offene Fragen zu klären. Einige davon beschäftigen sich speziell mit vulnerablen Gruppen wie Kindern oder Schwangeren. Zum Beispiel untersuchen Forschungsprojekte, ob es einen Zusammenhang zwischen der Mikroplastik-Belastung von Müttern und der Gesundheit ihrer Neugeborenen gibt. Erste Übersichtsarbeiten, wie die von Kam Sripada und Kollegen 2022, heben hervor, dass Kinder möglicherweise anders auf Mikroplastik reagieren als Erwachsene und dass dringend mehr Forschung nötig ist. Andere Forscher analysieren große Bevölkerungsgruppen, um festzustellen, ob Personen mit höherer Mikroplastik-Aufnahme (etwa Küstenbewohner oder Viel-Fisch-Esser) häufiger bestimmte Krankheiten haben. Epidemiologische Daten sind bislang rar, aber die kommenden Jahre dürften hier mehr Klarheit bringen.
Behördliche Einschätzung: Offizielle Stellen wie das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und das Umweltbundesamt beobachten die Studienlage genau. Stand jetzt kommen sie zu dem Schluss, dass es noch keine Beweise für akute Gesundheitsgefahren gibt. Das BfR schätzte 2021, dass es unwahrscheinlich sei, dass von Mikroplastik in Lebensmitteln erhebliche Gesundheitsrisiken ausgehen – betonte jedoch zugleich den Forschungsbedarf. Diese eher beruhigende Einschätzung basiert darauf, dass die meisten aufgenommenen Partikel wohl ausgeschieden werden und die bisher gemessenen Mengen sehr klein sind. Allerdings sagen auch die Behörden: Unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Sie raten, die weitere Entwicklung der Forschung abzuwarten. International haben Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ähnlich zurückhaltend argumentiert: Noch gebe es keine belastbaren Hinweise auf eine Gefahr, aber man müsse weiterforschen. Viele unabhängige Wissenschaftler hingegen äußern schon jetzt Besorgnis. Sie weisen darauf hin, dass wir in einer beispiellosen Situation sind – nie zuvor war der Mensch so flächendeckend feinsten Plastikpartikeln ausgesetzt – und dass Prävention besser sei als Abwarten. So gibt es Aufrufe, nach dem Vorsorgeprinzip zu handeln: also Maßnahmen zur Reduktion von Mikroplastik zu ergreifen, auch wenn letzte Beweise für den Schaden noch ausstehen. Schließlich hat es in der Vergangenheit (etwa bei Asbest oder bestimmten Pestiziden) Jahrzehnte gedauert, bis Gefahren wissenschaftlich bewiesen waren, während in der Zwischenzeit viele Menschen exponiert waren.
Komplexität der Wirkung: Ein Aspekt, den Forschung hervorhebt, ist die Komplexität: Mikroplastik ist nicht ein einzelner Stoff, sondern kommt in verschiedenen Größen, Formen und Materialien vor – vom runden Polyethylen-Kügelchen bis zur fasrigen PET-Faser. Zudem sind die Partikel oft mit Chemikalien behaftet, entweder als Bestandteil (Additive) oder als Adsorption aus der Umwelt (Schadstoffbelastung). Diese Vielfalt macht es schwierig, generalisierende Aussagen zu treffen. Manche Partikel könnten biologisch relativ inert sein, andere hochreaktiv. Wissenschaftler versuchen daher herauszufinden, welche Arten von Mikroplastik besonders gefährlich sein könnten – z.B. bestimmte Größen (Nanopartikel gelten als kritisch, weil sie Zellen direkt durchdringen können) oder bestimmte Polymertypen (etwa PVC, das Weichmacher enthält, versus z.B. biologisch eher passive Kunststoffe). Dazu kommt die Wechselwirkung untereinander: Wir sind ja nicht nur einem Stoff ausgesetzt, sondern einem Cocktail aus Plastikpartikeln und Chemikalien. Wie diese zusammen im Körper reagieren, ist nahezu unerforscht. Dieses Feld namens Plastik-Toxikologie wird aktuell erst aufgebaut.
Fazit aus Forschungssicht: Mikroplastik ist ein neues Umweltgift, das erst noch verstanden werden muss. Es gibt Grund zur Sorge, aber auch noch Ungewissheit. Forschende weltweit arbeiten mit Hochdruck daran, belastbare Antworten zu finden. Bis diese vorliegen, gilt in der Wissenschaftsgemeinde oft der Tenor: “Better safe than sorry” – sprich, lieber frühzeitig gegensteuern, als später einen möglichen Schaden zu bereuen. Die kommenden Jahre werden mehr Klarheit bringen, währenddessen sollten wir achtsam bleiben.
Ausblick
Mikroplastik ist zu einer sichtbar unsichtbaren Gefahr geworden – sichtbar in seiner allgegenwärtigen Präsenz als Umweltproblem, unsichtbar in seiner Gestalt und seinen schleichenden Wirkungen. Was können wir also erwarten, wie es mit diesem Thema weitergeht?
Mehr Forschung und Erkenntnisse: Zunächst einmal werden laufend neue Studien erscheinen, die hoffentlich die Frage beantworten, wie Mikroplastik unsere Gesundheit beeinflusst. Schon jetzt häufen sich die wissenschaftlichen Publikationen dazu exponentiell. Wir dürfen also in den nächsten Jahren mit deutlicheren Ergebnissen rechnen – etwa klaren Aussagen dazu, ob es einen Zusammenhang zwischen Mikroplastik-Belastung und bestimmten Krankheiten gibt. Auch technische Fortschritte in der Analytik (z.B. bessere Methoden, um kleinste Nanopartikel nachzuweisen) werden dazu beitragen, das Bild zu schärfen. Diese Forschung ist aufwendig und braucht Zeit, aber sie ist entscheidend, um fundierte gesundheitliche Bewertungen vornehmen zu können.
Politische Maßnahmen: Auf politischer und regulatorischer Ebene tut sich ebenfalls etwas. Die Problematik ist erkannt, und es werden Maßnahmen ergriffen, um Mikroplastik in der Umwelt zu verringern. In der EU tritt schrittweise ein Verbot für absichtlich zugesetztes Mikroplastik in Produkten in Kraft – zum Beispiel dürfen Mikroplastik-Peelingkügelchen in Kosmetika in einigen Jahren nicht mehr verwendet werden. Auch für andere Bereiche (Waschmittel, Farben, Kunstrasen) gibt es neue Auflagen, um den Eintrag von Mikropartikeln zu reduzieren. Zudem wird an der Verbesserung von Kläranlagen gearbeitet, damit mehr Mikroplastik aus dem Abwasser gefiltert wird, bevor es in Flüsse gelangt. Ein großes Thema ist der Reifenabrieb: Hier suchen Forscher und Industrie nach Lösungen, etwa neuen Gummimischungen oder Filtersystemen an Straßenabläufen, um diese Quelle einzudämmen. Zwar richten sich diese Maßnahmen primär an den Umweltschutz, doch mittel- und langfristig kommen sie natürlich auch unserer Gesundheit zugute – weniger Mikroplastik in der Umwelt bedeutet letztlich weniger Aufnahme in unseren Körper.
Was können wir persönlich tun? Dieser Artikel sollte zwar keine Alltagstipps geben, aber ein kurzer Ausblick sei erlaubt: Jeder einzelne kann durch bewusstes Verhalten dazu beitragen, die eigene Mikroplastik-Exposition zu senken – und den Eintrag in die Umwelt zu reduzieren. Sei es durch Müllvermeidung, Recycling, bewusste Kaufentscheidungen oder den Einsatz von plastikfreien Alternativen im Haushalt. Für Familien, Schwangere und Allergiker mag es beruhigend sein zu wissen, dass man nicht völlig hilflos ausgeliefert ist. In anderen Bereichen unserer Website (z.B. in den Tipps-Sammlungen) findest du Anregungen, was du konkret tun kannst, um Mikroplastik zu meiden. Insgesamt aber gilt: Das Problem Mikroplastik lässt sich nur gesamtgesellschaftlich lösen. Es braucht globale Anstrengungen, um die Plastikflut einzudämmen und unseren Planeten – und uns selbst – vor immer mehr unsichtbaren Plastikpartikeln zu schützen.
Ausblick in die Zukunft: Experten sprechen bereits vom Zeitalter des “Plastisols” – einer Erde, die von einer Schicht Mikroplastik bedeckt ist. Doch die Entwicklung ist nicht unumkehrbar. Innovationen in Materialwissenschaft (z.B. biologisch abbaubare Kunststoffe) und ein Umdenken in der Verwendung von Plastik könnten die Kurve kriegen. Für die Gesundheitsforschung bedeutet Mikroplastik ein neues, spannendes Feld: Umweltmediziner, Toxikologen und Epidemiologen werden in den nächsten Jahren intensiv untersuchen, welche vorbeugenden Maßnahmen sinnvoll sind und wie wir eventuelle gesundheitliche Folgen behandeln könnten. Vielleicht werden wir in Zukunft Grenzwerte für Mikroplastik in Lebensmitteln haben, ähnlich wie es heute Grenzwerte für Schwermetalle gibt. Möglicherweise entwickelt man auch Filter für die Luft in Innenräumen, um Plastikstaub herauszufiltern.
Noch sind viele dieser Punkte Vision. Aktuell heißt es für dich als gesundheitsbewusste*r Mensch: Informiert bleiben und das Thema ernst nehmen, ohne in Panik zu verfallen. Mikroplastik begleitet uns zwar überall, aber mit wachsendem Wissen und dem Willen zur Veränderung können wir dafür sorgen, dass diese unsichtbare Belastung Schritt für Schritt reduziert wird. Die Gesundheit deiner Familie und von zukünftigen Generationen wird es danken.