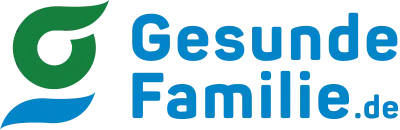Hausstaubmilben – Allergieauslöser und Gesundheitsrisiko
Wir alle kennen die kleinen Staubflusen unter dem Bett oder auf dem Regal. Hausstaub ist allgegenwärtig – und mit ihm auch winzige Mitbewohner: die Hausstaubmilben. Für Allergiker kann das zur echten Belastung werden. In diesem Ratgeber erfährst du, was Hausstaub eigentlich ist, warum sich Milben in unseren Wohnungen so wohlfühlen, wie dein Körper auf Milben-Allergene reagiert und welche Risiken besonders für Kinder, Schwangere und Allergiker bestehen.
 Symbolbild: Hausstaubmilben tummeln sich auf Hausstaubfasern.
Symbolbild: Hausstaubmilben tummeln sich auf Hausstaubfasern.
Was ist Hausstaub eigentlich?
Hausstaub ist viel mehr als nur Schmutz. In Wirklichkeit handelt es sich um eine fein gemischte Ansammlung verschiedenster Partikel aus unserer Wohnumgebung. Ein großer Anteil entsteht durch Textilfasern, die von Kleidung, Bettwäsche oder Teppichen abrubbeln. Dazu kommen Hautschuppen – sowohl von uns Menschen als auch von Haustieren – und Haare. Auch Pollen und kleine Pflanzenteile, winzige Insektenreste, Spinnweben und sogar eingetragener Staub von draußen (etwa feiner Sand) finden sich im Hausstaub. Diese sichtbaren Bestandteile werden ergänzt durch unsichtbare Feinstäube: winzige Partikel, die zum Beispiel beim Kochen oder Kerzenbrennen entstehen oder aus Laserdruckern in die Luft gelangen.
Hausstaub ist ständig in Bewegung. Unglaublich, aber wahr: In jedem Liter Innenraumluft können bis zu 50 Millionen Staubteilchen umherschweben. Warme Luft lässt sie aufsteigen, kühlt die Luft ab, sinken sie wieder und legen sich auf Flächen ab – daher sammeln sich in unbewegten Ecken oft besonders dicke Staubschichten. Jeder von uns wirbelt Staub auf: Schon bei leichter Bewegung setzen wir Millionen Partikel frei. Völlig staubfrei wird man seine Wohnung also nie bekommen – und das ist auch nicht schlimm, denn ein gewisses Maß an Staub gehört zur normalen Wohnumwelt.
Allerdings kann Hausstaub auch unangenehme Begleiter mitbringen. Zum einen dient er als Trägermaterial für Allergene (wie die Milben-Allergene, dazu gleich mehr) und sogar für Schadstoffe. Untersuchungen des Umweltbundesamtes fanden in Hausstaubproben z.B. Rückstände von Weichmachern, Bioziden, Flammschutzmitteln und sogar dem längst verbotenen Insektengift DDT. Das zeigt, dass Hausstaub ein Indikator für die Innenraumqualität ist: Er sammelt alles, was sich in unserer Raumluft befindet, an. Zum anderen fühlen sich darin bestimmte Kleinstlebewesen sehr wohl – vor allem die Hausstaubmilben, die im nächsten Abschnitt im Fokus stehen.
Milben im Haushalt: Warum sie sich bei uns so wohlfühlen
Hausstaubmilben (wissenschaftlich Dermatophagoides) sind winzige Spinnentierchen, nur etwa 0,1–0,5 mm groß, und mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Trotz ihres Namens leben sie nicht im Staub als solches, sondern bevorzugt in textilen Umgebungen: zum Beispiel in Matratzen, Bettdecken, Kissen, Polstermöbeln, Teppichen und Kuscheltieren – überall dort, wo sich Hausstaub und vor allem Hautschuppen ansammeln. Milben ernähren sich nämlich hauptsächlich von abgefallenen Hautpartikeln und Haaren. Unser Zuhause bietet ihnen reichlich Nahrung: Ein Mensch verliert pro Tag etwa 1 Gramm Hautschüppchen. Besonders im Schlafzimmer gibt es viel für Milben zu holen – hier besteht Hausstaub zu rund 80 % aus Hautschuppen. Kombiniert mit der Wärme und Feuchtigkeit, die wir im Schlaf abgeben (bis zu 200 ml Schweiß pro Nacht), entsteht in unseren Betten ein Paradies für Milben. Kein Wunder also, dass gerade Matratzen und Bettzeug oft wahre Milben-Hotspots sind.
Doch nicht nur dort: Milben finden sich in fast jedem Haushalt. Ihre Präsenz sagt nichts über mangelnde Hygiene aus – selbst in sauberen Wohnungen sind sie praktisch unvermeidbar. Die Tierchen sind Teil unserer natürlichen Innenraum-Umwelt. Sie bevorzugen ein feuchtwarmes Klima: Ideal sind relative Luftfeuchten über ~70 % und Temperaturen von 20–30 °C. In der Heizperiode im Winter sinkt die Luftfeuchtigkeit in Wohnungen oft ab, was viele Milben austrocknet und sterben lässt. Daher erreichen Milbenpopulationen meist im Spätsommer ihren Höhepunkt und gehen im Winter zurück – ganz verschwinden sie aber nie vollständig.
Eine einzelne Milbe hat nur eine Lebensdauer von ca. 2–3 Monaten, produziert in dieser Zeit aber enorm viel allergenhaltigen Kot. Tatsächlich hinterlässt eine Hausstaubmilbe in ihrem Leben etwa das 200-Fache ihres eigenen Körpergewichts an Kotpartikeln! Diese winzigen Kotkügelchen (Durchmesser ~0,03 mm) zerfallen und vermischen sich mit dem Staub. Sie können lange in der Wohnung überdauern, selbst wenn die Milbe längst tot ist. In gewöhnlichem Hausstaub finden sich daher stets sowohl lebende Milben als auch zahllose Milbenkot-Partikel. Wie hoch die Belastung sein kann, verdeutlicht ein Beispiel: Ein Teelöffel voll Schlafzimmerstaub enthält im Schnitt rund 1.000 Milben und bis zu 250.000 ihrer Kotkügelchen. Diese Kotpartikel sind es, die bei empfindlichen Menschen eine Allergie auslösen können.
Gut zu wissen: In Mitteleuropa kommen hauptsächlich zwei Milbenarten vor – Dermatophagoides pteronyssinus und Dermatophagoides farinae. Für den Allergiker macht das jedoch keinen Unterschied, beide Arten gelten als starke Allergenquellen.
Wie reagieren Körper und Immunsystem auf Milben & Co?
Die Hausstaubmilbe an sich würde unserem Körper nichts tun – ihre Ausscheidungen sind das Problem. Im Milbenkot befinden sich bestimmte Eiweißstoffe (Allergene), vor allem Verdauungsenzyme, die unser Immunsystem bei empfindlichen Personen fälschlicherweise als Bedrohung einstuft. Gelangen diese Allergene mit dem eingeatmeten Staub in unsere Atemwege, kann das eine ganze Kaskade an Abwehrreaktionen auslösen. Dein Körper reagiert also überempfindlich auf eigentlich harmlose Stoffe. Immunzellen produzieren spezifische IgE-Antikörper gegen das Milbenallergen. Diese Antikörper “markieren” das Allergen und heften sich an Abwehrzellen (z.B. Mastzellen) an. Beim nächsten Kontakt erkennen die Abwehrzellen das Allergen sofort und schütten Entzündungsbotenstoffe wie Histamin aus. Histamin verursacht die typischen Allergiesymptome: Es erweitert die Blutgefäße und macht die Schleimhäute durchlässiger – dadurch kommt es zu Schwellungen, Juckreiz und vermehrter Sekretbildung.
Typische Symptome einer Hausstaubmilben-Allergie betreffen meist die oberen Atemwege und Augen: Häufiges Niesen, eine laufende oder verstopfte Nase, Kribbeln im Hals und ständiges Räuspern, sowie juckende, tränende Augen gehören dazu. Manche Betroffene entwickeln auch Hautreaktionen wie Nesselausschlag oder eine Verschlechterung von Ekzemen. Viele fühlen sich durch die dauernde allergische Reizung allgemein erschöpft und müde. Nicht selten kommen asthmatische Beschwerden hinzu: chronischer Husten, pfeifende Atmung bis hin zu Atemnot insbesondere in der Nacht. Typisch für Hausstaub-Allergiker ist, dass die Symptome ganzjährig auftreten (im Gegensatz zum saisonalen Heuschnupfen) und besonders morgens nach dem Aufwachen oder beim Bettenmachen stark sind – weil während der Nacht viele Milbenallergene aus der Bettwäsche aufgewirbelt wurden.
Ohne Behandlung kann eine Hausstaub-Allergie im Laufe der Zeit schlimmer werden. Ärzte warnen vor dem sogenannten Etagenwechsel: Etwa drei Viertel der unbehandelten Hausstaub-Allergiker entwickeln innerhalb von 10 Jahren Asthma. Das bedeutet, dass sich der anfängliche “Hausstaubschnupfen” auf die Bronchien ausweitet und zu chronischem allergischen Asthma führen kann. Zudem können Milbenallergene auch andere allergische Erkrankungen beeinflussen – so treten bei Hausstaubmilben-Allergikern überdurchschnittlich oft Neurodermitis-Schübe auf. Deshalb ist es wichtig, die Allergie ernst zu nehmen und die Auslöser möglichst zu meiden. Treten die genannten Beschwerden bei dir oder deinem Kind hauptsächlich zu Hause und über das ganze Jahr hinweg auf, solltest du das vom Arzt abklären lassen. Ein Allergietest (z.B. Prick-Test auf der Haut) kann eindeutig zeigen, ob Hausstaubmilben der Auslöser sind.
Welche Risiken bestehen speziell für Kinder, Schwangere und Allergiker?
Kinder
Für Kinder kann Hausstaub besonders kritisch sein, da ihr Immunsystem noch im Training ist. Viele Allergien entwickeln sich bereits im frühen Kindesalter. Babys und Kleinkinder kommen durch Krabbeln und Spielen viel mit Hausstaub in Kontakt – und atmen dabei auch Milbenallergene ein. Studien haben gezeigt, dass bei einer Milbenallergen-Konzentration von über ca. 2 Mikrogramm pro Gramm Staub das Risiko deutlich steigt, dass sensibilisierungsanfällige Personen (etwa erblich vorbelastete Kinder) eine Hausstaubmilben-Allergie entwickeln. Wird dieses Kind dann allergisch, erhöht sich wiederum sein Risiko für Asthma: Kinder mit Hausstaubmilben-Sensibilisierung entwickeln deutlich häufiger langfristige Atemwegsprobleme und benötigen mehr Asthmamedikamente. Mit anderen Worten: Eine starke Milbenbelastung in der Wohnumgebung kann bei empfindlichen Kindern Allergien fördern und Asthma begünstigen.
Auch die erbliche Veranlagung spielt eine große Rolle. Ist ein Elternteil allergisch, liegt das Allergierisiko für das Kind bei etwa 20–40 %. Sind beide Eltern betroffen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf 40–60 %, und wenn Vater und Mutter an derselben Allergie leiden (z.B. beide Hausstaubmilbenallergisch sind), beträgt das Risiko für das Kind sogar 60–80 %. Das heißt nicht, dass ein allergiegefährdetes Kind unbedingt erkrankt – aber Vorsicht ist geboten. Eltern sollten auf Anzeichen wie häufige “Pseudo-Erkältungen” (Niesen, verstopfte Nase ohne Infekt) oder anhaltenden Husten bei ihrem Kind achten. Gegebenenfalls kann frühzeitiges Eingreifen, etwa durch allergenarme Schlafumgebung, das Immunsystem des Kindes entlasten.
Schwangere
In der Schwangerschaft selbst verändert sich das Immunsystem der Frau – Allergien können in dieser Zeit schwächer oder stärker ausgeprägt auftreten. Für Schwangere mit Hausstauballergie bedeutet das: Die üblichen Symptome wie Niesattacken, Naselaufen und eventuell asthmatische Beschwerden können durchaus weiterhin auftreten und sind nicht immer vorhersehbar. Das ist nicht nur unangenehm, sondern z.B. bei starkem allergischem Asthma auch ein indirektes Risiko fürs ungeborene Kind (durch die Belastung der Mutter). Daher ist es wichtig, auch in der Schwangerschaft die Allergie gut zu behandeln (in Absprache mit dem Arzt, viele Antiallergika wie bestimmte Nasensprays oder Antihistaminika dürfen auch in der Schwangerschaft verwendet werden).
Werdende Mütter fragen sich oft, ob sie etwas tun können, damit ihr Baby später keine Allergie entwickelt. Eine Garantie gibt es zwar nicht – zu stark wirken die genetischen Faktoren mit. Aber man weiß, dass Allergenvermeidung in der Umgebung des Neugeborenen sinnvoll ist. Deshalb empfiehlt es sich, schon vor der Geburt das Wohnumfeld möglichst milbenarm zu gestalten (siehe Tipps weiter unten), vor allem wenn in der Familie Allergien bekannt sind. Denn wie oben erwähnt, hat ein Kind allergischer Eltern ein deutlich erhöhtes Allergierisiko. Mit einer möglichst niedrigen Allergenbelastung kann man zumindest vermeiden, dass der kleine Organismus unnötig früh “getriggert” wird.
Allergiker
Für Allergiker selbst – also Menschen, die bereits an einer Hausstaubmilben-Allergie oder anderen Allergien leiden – ist Hausstaub quasi ein ständiger Begleiter, der gemanagt werden muss. Hausstaubmilben-Allergiker haben ohne geeignete Maßnahmen ganzjährig Beschwerden, die die Lebensqualität stark beeinträchtigen können: dauernder Schnupfen, Schlafstörungen durch verstopfte Nase oder nächtliche Hustenanfälle, Konzentrationsprobleme am Tag infolge von Müdigkeit, etc. Unbehandelt besteht die Gefahr, dass sich allergischer Schnupfen zu chronischem Asthma ausweitet. Außerdem haben einige Milbenallergiker auch mit Kreuzallergien zu kämpfen – zum Beispiel reagieren manche auf Hausstaubmilben sensibilisierte Personen auch allergisch auf Schalentiere wie Garnelen oder Haus-schnecken, da ähnliche Eiweißstrukturen (Tropomyosin) beteiligt sind. Das ist aber individuell unterschiedlich.
Wer bereits andere Allergien hat (etwa Heuschnupfen), entwickelt nicht selten zusätzlich eine Sensibilisierung gegen Hausstaubmilben im Laufe seines Lebens. Das Immunsystem “sammelt” sozusagen Allergien, vor allem wenn eine erbliche Veranlagung besteht. Daher sollte man auch als Pollenallergiker auf sein Wohnklima achten – eine hohe Staub- und Milbenbelastung kann die Gesamtsymptomatik verschlechtern. Umgekehrt gibt es Hinweise, dass eine Allergie-Therapie wie die spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung) gegen Hausstaubmilben nicht nur die Milbenallergie lindern kann, sondern auch das Risiko verringert, neue Allergien zu entwickeln oder ein Asthma zu verhindern. Für Allergiker lohnt es sich also doppelt, das Thema Hausstaub ernst zu nehmen und die Belastung zu reduzieren.
Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse zur Hausstauballergie
Hausstaubmilben gehören weltweit zu den häufigsten Auslösern von Allergien in Innenräumen. In Mitteleuropa sind schätzungsweise 5–10 % der Bevölkerung gegen Milbenallergene sensibilisiert. In der Schweiz etwa sind rund 6 % der Kinder und Erwachsenen von einer Hausstaubmilbenallergie betroffen. Auch in Deutschland liegt die Zahl in etwa in diesem Bereich. Gleichzeitig haben etwa 20–30 % aller Menschen eine allgemeine Allergieneigung (Atopie). Die Hausstaubmilben-Allergie ist damit ein bedeutendes Feld für die Forschung, insbesondere weil sie häufig zu chronischem Asthma führen kann.
Wissenschaftliche Studien belegen den Zusammenhang zwischen Milben und Atemwegserkrankungen eindrucksvoll. So wurde ermittelt, dass Hausstaubmilben-Allergen in ausreichender Konzentration nicht nur Allergiesymptome triggert, sondern sogar die Entstehung von Asthma begünstigt. Eine Expertenkommission der US National Academy of Sciences hat die Evidenz als “ausreichend” eingestuft, um Hausstaubmilben-Allergene als Ursache für die Entwicklung von Asthma sowie für Asthma-Verschlechterungen bei bestehenden Asthmatikern anzuerkennen. Konkret zeigte Forschung: Wenn die Milbenallergen-Belastung in Hausstaub einen Schwellenwert von etwa 2 µg pro Gramm Staub übersteigt, steigt das Risiko für anfällige Personen, überhaupt erst allergisch auf Milben zu reagieren, deutlich an. Für bereits Sensibilisierte können solche Konzentrationen zu heftigen Beschwerden führen. Eine frühere Richtlinie der WHO nennt 2 µg/g Staub als Sensibilisierungsschwelle für Milbenallergene.
Ein aktuelles Beispiel aus der Forschung: 2025 berichteten deutsche Wissenschaftler, dass bei kleinen Kindern mit bronchialer Überempfindlichkeit eine nachgewiesene Hausstaubmilbenallergie ein starker Risikofaktor für dauerhaftes Asthma ist. Kinder, die in der Studie positiv auf Milben allergisch waren und gleichzeitig überreagible Bronchien hatten, benötigten häufiger Asthma-Medikamente und zeigten wahrscheinlicher anhaltende Atemwegsprobleme. Dieses Ergebnis unterstreicht, wie wichtig es ist, gefährdete Kinder früh zu identifizieren und zu behandeln, um spätere Asthmaerkrankungen zu mindern. Solche Erkenntnisse fließen in die Allergie-Leitlinien ein und helfen Ärzten, optimale Therapien zu finden – etwa wann eine Immuntherapie („Allergie-Impfung“) gegen Milben sinnvoll ist.
Interessant ist auch der Blick auf schützende Faktoren: Warum werden nicht alle Menschen mit Milbenkontakt allergisch? Studien zeigen, dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen. So gibt es den sogenannten Bauernhof-Effekt: Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen und früh mit vielfältigen Mikroorganismen und „natürlichem Staub“ in Kontakt kommen, haben ein geringeres Allergie- und Asthmarisiko. Offenbar trainiert eine bestimmte Vielfalt an Keimen das kindliche Immunsystem so, dass es später weniger zu Überreaktionen neigt. Diese Erkenntnis liefert spannende Ansätze, wie man Allergien vielleicht vorbeugen könnte – etwa durch Förderung einer gesunden häuslichen Mikroflora. Ganz verstanden sind diese Zusammenhänge aber noch nicht.
Insgesamt wird deutlich, dass Hausstaub und Milben in der Innenraum-Medizin ernstzunehmende Faktoren sind. Die Forschung geht weiter: Von genetischen Einflüssen über Immuntherapie-Studien bis hin zu Untersuchungen, wie sich Klimawandel (feuchteres Klima kann Milben verbreiten) oder verbesserte Wohnlüftung auf die Allergenbelastung auswirken. Klar ist aber schon jetzt: Je weniger Milbenallergen wir abbekommen, desto besser für die Gesundheit – vor allem, wenn man allergiegefährdet ist.
Gesetzliche und medizinische Richtwerte, Empfehlungen
Für Hausstaub als Umweltfaktor gibt es zwar keine gesetzlichen Grenzwerte wie etwa für Außenluft-Schadstoffe, doch Fachorganisationen haben Richtwerte vorgeschlagen. Wie erwähnt, gelten 2 µg Milbenallergen pro Gramm Staub als Schwellenwert, ab dem eine Sensibilisierung möglich ist. Allergologen empfehlen, die Wohnraum-Belastung möglichst unter diesem Wert zu halten, um eine Allergieentstehung zu verhindern. Bei bekannten Allergikern sollte der Wert idealerweise noch niedriger liegen. In der allergologischen Literatur wird häufig genannt, dass <2 µg/g Staub anzustreben sind, um Sensibilisierungen zu vermeiden, und <10 µg/g Staub, um akute Symptome bei bereits Allergischen zu verhindern. Zum Vergleich: In einem gramm Staub können – je nach Hygienezustand – mehrere tausend Milben und zigtausende Mikrogramm Kot enthalten sein. Es braucht also konsequente Maßnahmen, um die Allergenmenge unter solche Grenzen zu drücken.
Medizinische Leitlinien zur Hausstaubmilben-Allergie raten vor allem zur Allergenvermeidung in der Umgebung des Betroffenen (Allergenkarenz). Einige empfohlene Maßnahmen zur Reduktion der Hausstaub- und Milbenbelastung sind:
-
Raumklima optimieren: Milben mögen es warm und feucht. Eine relative Luftfeuchtigkeit unter 50 % und regelmäßiges Lüften machen Milben das Leben schwer. In der Heizperiode sinkt die Luftfeuchtigkeit oft von selbst ab, was Milben dezimiert. In feuchten Wohnungen kann ein Luftentfeuchter sinnvoll sein. Die Raumtemperatur sollte eher kühl-mäßig (max. ~20 °C im Schlafzimmer) gehalten werden.
-
Bett milbendicht ausstatten: Da das Bett der Hauptlebensraum der Milben ist, steht es im Fokus. Allergikern wird geraten, Matratzen, Decken und Kissen mit speziellen encasing-Bezügen zu versehen. Diese allergendichten Überzüge lassen keine Milben und Allergenteilchen hindurch. Wichtig ist, wirklich alle Bettwaren einzuhüllen und die Encasings regelmäßig zu reinigen. Die Bettwäsche (Bezüge) darüber sollte auswechselbar und waschbar sein.
-
Heiß waschen: Wasche Bettbezüge, Laken und wenn möglich auch Decken und Kissen alle 4–6 Wochen bei mindestens 60 °C (besser 90 °C). Die hohen Temperaturen töten Milben ab und entfernen einen Großteil der Allergene. Auch Kuscheltiere des Kindes kannst du ab und zu heiß waschen (oder alternativ für 24 Stunden ins Tiefkühlfach legen und danach absaugen, um Milben abzutöten).
-
Staubentfernung: Halte die Wohnung so staubarm wie praktikabel. Beim Putzen empfiehlt sich feuchtes Wischen statt aufzuwirbeln. Verwende Staubtücher aus Microfaser, die den Staub festhalten, anstatt ihn nur zu verteilen. Beim Staubsaugen sollte ein Gerät mit HEPA-Filter genutzt werden, damit die feinsten Allergenteilchen nicht wieder hinten rausgepustet werden. Herkömmliche Staubsauger ohne geeigneten Filter verteilen den Milbenstaub oft nur neu in der Luft. Noch besser sind Spezialsauger oder Dampfsauger, die Milben in Teppichen und Matratzen reduzieren können. Beim Saugen und Bettenmachen kann ein Allergiker auch eine Feinstaubmaske tragen, um die direkte Allergenaufnahme zu verringern.
-
Weniger Staubfänger: Überlege, wie du dein Zuhause allergikerfreundlich gestalten kannst. Teppichböden, Vorhänge und überladene Regale sammeln viel Staub – glatte Böden (wischbar) und leicht abwaschbare Oberflächen sind von Vorteil. Verzichte im Schlafzimmer möglichst auf schwere Vorhänge und verstaube Samtstoffe. Bettvorleger regelmäßig reinigen oder entfernen. Lüfte Polstermöbel und Kissen gelegentlich im Freien und klopfe sie aus (vorsichtig, Allergiker sollten das besser anderen überlassen).
-
Tierhaare und Schimmel vermeiden: Tierhalter sollten wissen, dass Katzen- oder Hundehaare oft zusätzlich Allergene binden, die im Staub landen. Auch Schimmelpilz in der Wohnung kann das Immunsystem belasten; Milben ernähren sich teilweise von Schimmelpilzen, weshalb Feuchtigkeit doppelt problematisch ist. Achte also auf ein trockenes Wohnklima, um sowohl Schimmel als auch Milben in Schach zu halten.
Neben diesen Umweltmaßnahmen gehört zur medizinischen Betreuung einer Hausstauballergie natürlich die Therapie der Symptome (etwa mit Antihistaminika, Nasensprays, Asthma-Inhalationen) und – falls geeignet – eine spezifische Immuntherapie. Letztere kann über 3 Jahre das Immunsystem an das Allergen gewöhnen, sodass es weniger heftig reagiert. Sprich mit deinem Arzt, welche Optionen für dich oder dein Kind sinnvoll sind.
Abschließend lässt sich sagen: Hausstaub und Milben sind zwar allgegenwärtig, aber man ist ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Mit etwas Wissen und konsequenter Hygiene lassen sich die „Mitbewohner“ in Schach halten. Wenn du dich an die Empfehlungen hältst, schaffst du ein Umfeld, in dem auch Allergiker gesund leben und durchatmen können.